Bundesratswahl: Die Herausforderung der Grünen

Die Grüne Partei will in den Bundesrat: Die Delegierten nominierten am Samstag für die Bundesratswahl vom 12. Dezember den Waadtländer Ständerat Luc Recordon als Gegenkandidaten zu Christoph Blocher.
Die Grünen, die bei den Parlamentswahlen im Oktober stark zugelegt haben, fordern zudem von den anderen Parteien in ökologischen und sozialen Fragen Tatbeweise.
Die Grünen stellen bei der Bundesratswahl vom kommenden 12. Dezember mit dem Waadtländer Ständerat Luc Recordon einen Gegenkandidaten zu Christoph Blocher.
Die Delegierten der Grünen Partei unterstützten am Samstag in Binningen im Kanton Basel-Landschaft den Vorschlag ihres Vorstands mit 115 zu 35 Stimmen. Zuvor hatten sie sich mit 132 zu 16 Stimmen grundsätzlich für eine Bundesrats-Beteiligung ausgesprochen.
Angesichts der Politik Blochers sei seine Gegenkandidatur keine Arroganz, sondern eine Pflicht, sagte Recordon. Der Justizminister stelle die liberalen Grundwerte und die Priorität des internationalen Rechts in Frage.
Die Person Recordons war unbestritten. Zwar sei der 52-Jährige in der Deutschschweiz noch nicht so bekannt, sagte die abtretende Parteipräsidentin Ruth Genner. In der Romandie sei er jedoch ein Star. Recordon ist vor drei Wochen im zweiten Wahlgang in den Ständerat gewählt worden. Er war vorher vier Jahre im Nationalrat.
Warnung vor Alleingang
Die Machtbeteiligung löste eine engagierte Debatte aus. Eine klare Mehrheit der Voten sprach sich für ein Bekenntnis für die grünen Ziele aus, also für die Kandidatur ohne Rücksicht auf die realen Wahlchancen. Gegner, zumeist Deutschschweizer, rieten, besser bis zu einem Rücktritt zuzuwarten.
Der Zürcher Nationalrat Daniel Vischer warnte vor einem aussichtslosen Alleingang, auch wenn die Grünen rechnerisch einen Sitz zu Gute hätten. Arithmetisch müssten die Grünen den zweiten Sitz der Freisinnig-Demokratischen Partei (FDP) ins Visier nehmen. Doch zuvor seien Allianzen zu schmieden; ein Wahlflop würde nur wieder Blocher stärken.
Wechsel in Klimapolitik
Für einen Wechsel in der Klimapolitik brauche es auch einen Wechsel in der Landesregierung, sagte der Genfer Nationalrat Ueli Leuenberger.
Die Nationalrätin Maya Graf sprach angesichts der Wahlerfolge vom vergangenen 21. Oktober von einem fast historischen Anlass. «Wir stehen vor dem Schritt, auch im Bundesrat Verantwortung zu übernehmen», sagte sie.
Noch nie hätten so viele Wählerinnen und Wähler grün gewählt, fügte auch Ruth Genner an. «Das bedeutet für uns aber auch Verantwortung».
Entscheidend werde in der kommenden Legislatur in ökologischen und sozialen Fragen sein, wie sich die heterogene Grossfraktion bestehend aus derChristlichdemokratischen Partei (CVP), Grünliberalen und der Evangelischen Volkspartei der Schweiz (EVP) positioniere. Wenn die Klimaveränderung wirklich gestoppt werden solle, brauche es nach dem vielen Geschwätz endlich Tatbeweise.

Mehr
Bundesrat
«Regierungsfiasko»
Nationalrat Ueli Leuenberger fügte an, angesichts der dramatischen Lage im Klimabereich sei schnelles Handeln aller politischen Verantwortungsträger angesagt. UN-Generalsekretär Ban Ki-Moon habe im Hinblick auf die Weltklimakonferenz in Bali gesagt, die Wissenschaft spreche in Sachen Klimawandel mit einer Stimme, und er erwarte von der Politik das gleiche. In der Schweiz sei man davon aber noch weit entfernt, sagte Leuenberger.
Nach vier Jahren Regierungsfiasko brauche es einen Wechsel. Der Bundesrat, der sich am stärksten gegen Massnahmen gegen den Klimawandel wehre, müsse ausgetauscht werden.
Die Grünen hatten bereits 1987 und 1991 mit Leni Robert für den Bundesrat kandidiert. Auch damals zielten sie auf einen Sitz der Schweizerischen Volkspartei (SVP), den von Adolf Ogi. Robert kam jeweils nicht über den ersten Wahlgang hinaus. Im Jahr 2000 kandidierte die Grüne Cécile Bühlmann für Ogis Nachfolge – ebenfalls erfolglos.
swissinfo und Agenturen
Nach der Geburt des modernen Bundesstaates im Jahr 1848 besetzte die Freisinnig-Demokratische Partei während vier Jahrzehnten alle sieben Bundesratssitze.
Erst im Jahr 1891 konnte zum ersten Mal auch die Christlichdemokratische Volkspartei (früher Katholisch-Konservative Volkspartei) einen Bundesrat stellen.
Die Schweizerische Volkspartei (früher Bauern-, Gewerbe- und Bürgerpartei) trat erstmals 1929 der Regierung bei.
Die Sozialdemokratische Partei erhielt ihren ersten Sitz in der Regierung im Jahr 1943.
Seit 1959 setzt sich die schweizerische Regierung immer aus diesen vier Parteien zusammen, die rund 80% der Wählerstimmen auf sich vereinen.
Parteienstärken:
Schweizerische Volkspartei: 29% (+2,3% gegenüber 2003)
Sozialdemokratische Partei: 19,5% (-3,8%)
Freisinnig-Demokratische Partei: 15,6% (-1,7%)
Christlichdemokratische Partei: 14,6% (+0,2%)
Grüne Schweiz: 9,6% (+1,7%)

In Übereinstimmung mit den JTI-Standards



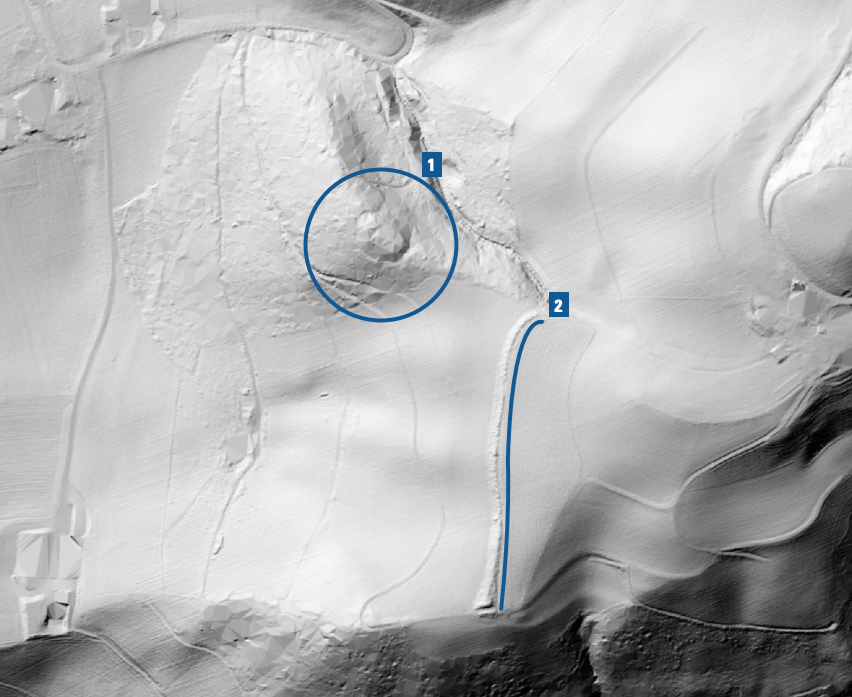








Einen Überblick über die laufenden Debatten mit unseren Journalisten finden Sie hier. Machen Sie mit!
Wenn Sie eine Debatte über ein in diesem Artikel angesprochenes Thema beginnen oder sachliche Fehler melden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an german@swissinfo.ch