Was sind flankierende Massnahmen?

In der Schweiz darf niemand billig arbeiten. Arbeitgebende, Gewerkschaften und Staat haben flankierende Massnahmen installiert. Wie funktionieren sie?
Lohnschutz heisst im Verständnis der Gewerkschaften: Für gleiche Arbeit am gleichen Ort soll gleich viel Lohn bezahlt werden. Das ist nicht einfach zu erreichen, denn es ist im Grunde ein sozialistischer Gedanke.
Freie Marktwirtschaft aber funktioniert kapitalistisch. Sie sucht immer Gelegenheiten und braucht Wettbewerb, um sich ständig zu erneuern.
Der sozialistische Anspruch in einem kapitalistischen Umfeld führt zu einem ständigen Tauziehen. Das geht so: Wirtschaftsverbände und Gewerkschaften handeln Gesamtarbeitsverträge aus. Sie definieren Mindestlöhne und weitere Bedingungen.
Haben die Sozialpartner dies definiert, kann in der Schweiz der Staat die Ergebnisse als allgemeinverbindlich erklären. Es ist ein System, das auf der Kooperation der Sozialpartner beruht.
Auch dieses benötigt aber Disziplinierung, wie im Strassenverkehr funktioniert sie mit drei Elementen: Es braucht erstens Regeln und sie müssen zweitens kontrolliert werden. Wird gegen sie verstossen, braucht es drittens Sanktionen.
Was sind Entsendungen?
Im Fall der Schweiz sind die Regeln im Entsendegesetz festgehalten,Externer Link auch «Bundesgesetz über die Flankierenden Massnahmen» genannt. Entsendung? Der Begriff beschreibt Arbeit, die jenseits einer Landesgrenze verübt wird. Das ist nicht zu verwechseln mit pendelnden Grenzgängern, die in der Schweiz angestellt sind. Entsandte haben Arbeitsverträge bei Unternehmen aus der EU, sie werden von diesen in ein anderes Land entsandt.
Warum flankierende Massnahmen?
Die Schweiz registriert in Europa – mit Ausnahme von Luxemburg – am meisten Entsandte. Das hat nicht nur mit den gut bezahlten, attraktiven Aufträgen zu tun. Ein Faktor ist auch der Sprachmix der Schweiz. 220 Millionen EU-Bürger können in ihrer eigenen Sprache in der Schweiz arbeiten. Effektiv ist aber der Beschäftigungsanteil von Entsandten an der Schweizer Wirtschaft überschaubar, er beträgt 0,2 Prozent.
Wie sehen die flankierenden Massnahmen aus?
Ein Gipserbetrieb aus Italien kann seine Arbeitnehmenden zwar jederzeit in die Schweiz schicken, aber nur während 90 Arbeitstagen pro Jahr. Dazu muss er seine Arbeiten in der Schweiz 8 Tage vorgängig bei den Schweizer Behörden anmelden. So kann kontrolliert werden, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Der Betrieb muss auch Schweizer Mindestlöhne bezahlen und die in der Schweiz geltenden Rahmenbedingungen, etwa bezüglich Unterkunft, einhalten.
Wie sehen die Kontrollen aus?
Kontrollen können jederzeit stattfinden und die Befugnisse der Inspektoren sind umfassend: Sie dürfen alle Dokumente, Baustellen und Tätigkeiten einsehen. Die Inspektoren werden zur Hälfte vom Bund bezahlt, zur Hälfte von den Gewerkschaften.
All dies zusammen bezeichnet man auch als «flankierende Massnahmen», sie begleiten schützend die Öffnung der Schweizer Wirtschaft für Europa.
Was ist die Schweizer Besonderheit?
Auch andere Länder in Europa kennen Lohnschutz-Massnahmen. Denn auch Deutschland oder Österreich haben mit Ungarn, Tschechien oder Polen zum Beispiel Nachbarn mit eigentlichen Lohnklippen. Der Unterschied des Schweizer Systems aber liegt in der Umsetzung.
Insbesondere bei folgenden Fragen ist das Schweizer System anders als das europäische: Wie wird überwacht? Und wie wird sanktioniert?
In der Schweiz werden die Regeln von sogenannt «tripartiten Kommissionen» beaufsichtigt – also von drei Parteien: Arbeitgebende, Gewerkschaften, plus Behörden. Zu dritt können sie Gesamtarbeitsverträge als allgemeinverbindlich erklären und ihre Gültigkeit garantieren.
«Dieses Mittel ist nicht nur effektiver, es stabilisiert auch das System», sagt Gewerkschaftsforscher Roland ErneExterner Link vom University College Dublin. Laut Erne gibt in Europa eine bisher vorherrschende Meinung: Hoheitliche Aufgaben könnten nur Beamte machen, und nicht Sozialpartner. In der Schweiz aber überlässt der Staat die Verhandlungsarbeit sozusagen den Profis, den beiden Seiten des Gewerbes, die paritätisch agieren. Nur um Verbindlichkeit herzustellen, kommt er als dritte Partei dazu.
Man spricht von einem » korporatistischen Kontrollregime», die drei Parteien bilden einen «Körper».
Was sind die Sanktionen?
Auch bei den Sanktionen gibt es eine Schweizer Besonderheit: die Konventionalstrafen. Der Schweizer Weg kommt auch hier ohne Eingriff der staatlichen Hoheit aus, also ohne Gericht. Das macht etwa anonyme Tipps möglich. Ein Vertragspartner bezahlt bei Verstössen eine Vertragsstrafe. Der Staat bleibt wieder aussen vor.
Kommt dazu: Die Schweiz setzt bei den flankierenden Massnahmen auf Kautionen. Das sind vorsorglich hinterlegte Garantiegelder, die Firmen beim Grenzübertritt als Depot leisten müssen. Sie haben eine abschreckende Wirkung. Und man stellt so sicher, dass Bussen auch eingetrieben werden können. Die Bussen sind hart. Wer die Regelungen systematisch unterläuft, wird mit bis zu einer Million Franken gebüsst.
Kautionen kennt die EU übrigens auch, etwa im Mietrecht, aber nicht im Arbeitsrecht.

In Übereinstimmung mit den JTI-Standards



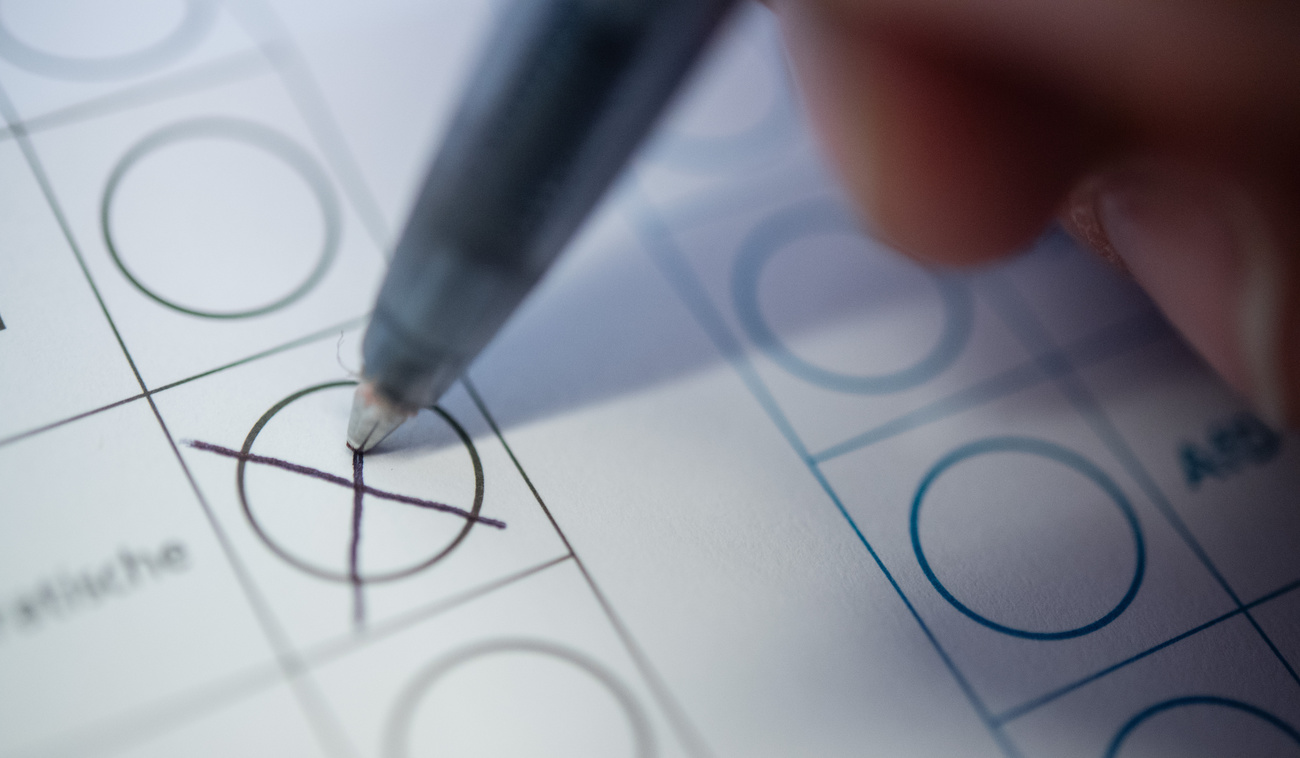










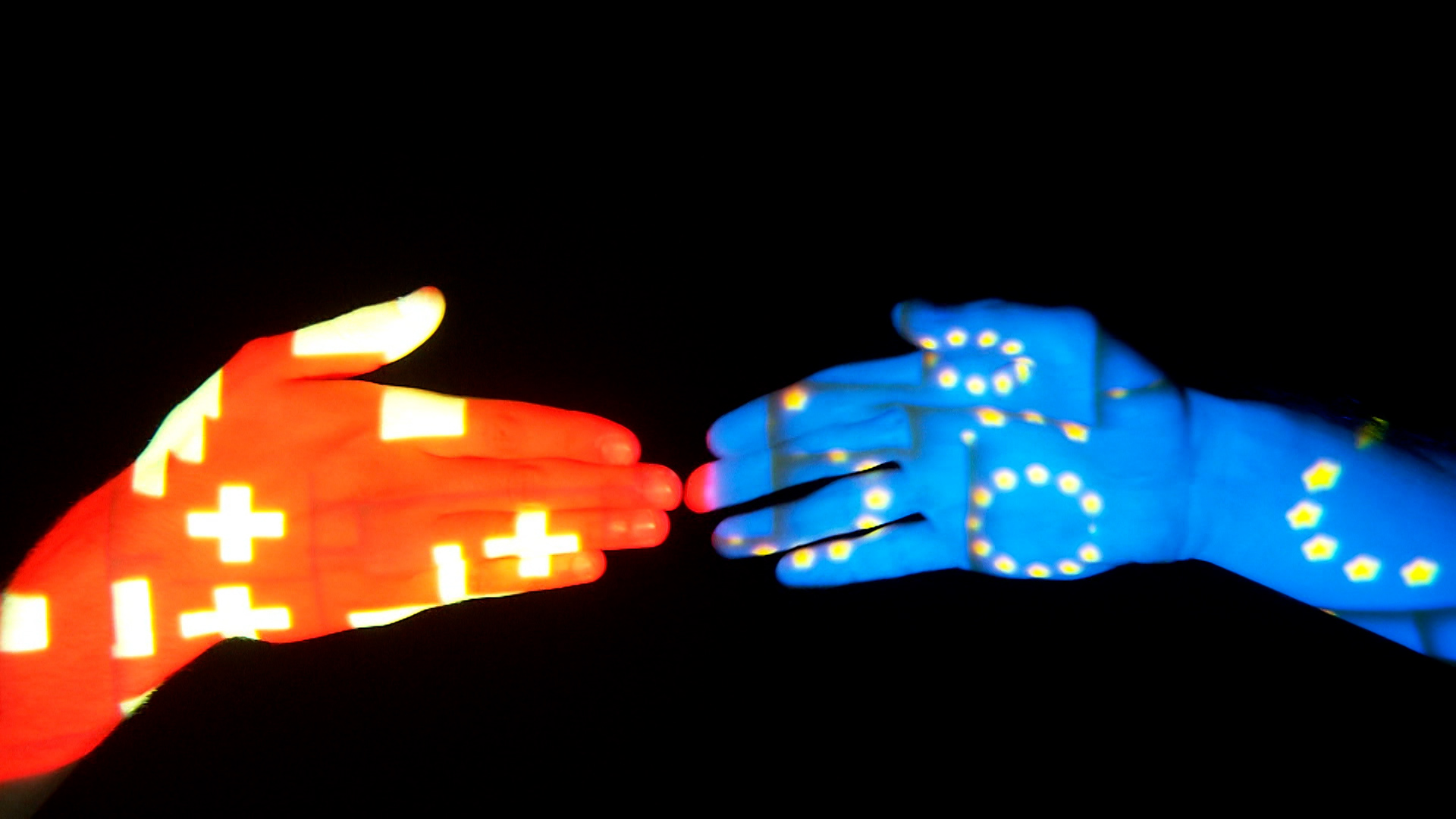
Einen Überblick über die laufenden Debatten mit unseren Journalisten finden Sie hier. Machen Sie mit!
Wenn Sie eine Debatte über ein in diesem Artikel angesprochenes Thema beginnen oder sachliche Fehler melden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an german@swissinfo.ch