Die Schweiz und die EMRK: Das sind die wichtigsten Meilensteine

Vor fünfzig Jahren ratifizierte die Schweiz die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK). Viele hielten die Schweizer Gesetzgebung für so fortschrittlich, dass sie dachten, das Land würde nie gerügt – eine Vorstellung, die sich als falsch erwies.
1974, als die Schweiz die Europäische Menschenrechtskonvention ratifizieren sollte, setzte sich Aussenminister Pierre Graber vor dem Parlament für eine Unterzeichnung ein.
Es sei sehr unwahrscheinlich, dass die Schweiz mit ihren hohen Standards wegen eines Verstosses zur Rechenschaft gezogen werden würde, so Graber.
Viele waren der Ansicht, die Gesetze des Landes würden den Standards der Konvention und dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) in Strassburg genügen.
Sie hatten sich geirrt. Die Schweiz gehört zwar bei weitem nicht zu jenen Ländern mit den schlimmsten Verstössen gegen die Menschenrechtskonvention. Dennoch wurde sie vom Gerichtshof rund 140-mal zur Rechenschaft gezogen.
Im Lauf der letzten fünfzig Jahre haben diese Urteile sowie der sich abzeichnende Einfluss der Konvention im Allgemeinen wie auch das Justizsystem des Landes im Besonderen nachhaltig geprägt.
1971 – besser spät als nie

Im Vergleich zu ihren Nachbarländern war die Schweiz bei der Ratifizierung der Konvention spät. Das lag unter anderem daran, dass sie in einer anderen Frage hinterherhinkte: Bis 1971 konnten Schweizer Frauen auf Bundesebene nicht abstimmen.
Da die Menschenrechte bekanntlich für alle Menschen und nicht nur für Männer gelten, war dies ein Problem. Die Behörden suchten nach Möglichkeiten, die Konvention in jedem Fall zu ratifizieren, konnten sich aber nicht einigen.
Letztendlich war die EMRK ein entscheidender Faktor, der die Schweiz dazu brachte, endlich das allgemeine Wahlrecht einzuführen. In einer Abstimmung im Jahr 1971 akzeptierten die Schweizer Männer die politische Gleichstellung der Schweizer Frauen auf nationaler Ebene; drei Jahre später unterzeichnete das Land die Konvention.
1981 – Ende eines dunklen Kapitels

In einem anderen Fall von Diskriminierung in der Schweiz war die Situation ähnlich. Über Jahrzehnte hinweg wurden unter der «administrativen Fürsorge» bis zu 60’000 Menschen ohne Gerichtsverfahren und ohne ein Delikt begangen zu haben inhaftiert.
Diese Praxis richtete sich gegen Menschen, die nicht den gesellschaftlichen Normen entsprachen, etwa als «liederlich» oder «trunksüchtig» galten; viele waren Mädchen, die nach einer ausserehelichen Schwangerschaft gemieden wurden.
Auch Waisenkinder oder uneheliche Kinder wurden zwangsweise in Pflegefamilien oder Heimen untergebracht.
In den 1960er-Jahren wurde Kritik an solchen Praktiken laut, doch erst nach der Ratifizierung der Konvention in den 1970er-Jahren – besonders von Artikel 5Externer Link – wurde die Politik aktiv. 1981 wurde die administrative Betreuung offiziell beendet.
1988 – das Recht auf ein unparteiisches Rechtsmittel

1981 wurde die Lausanner Studentin Marlène Belilos zu einer Geldstrafe verurteilt, weil sie an einer nicht genehmigten Demonstration teilgenommen hatte. Sie focht die Anklage an: Sie sei zu der Zeit woanders gewesen.
Nachdem eine Polizeikommission ihren Einspruch abgelehnt hatte, wiesen ihn auch die Gerichte zurück – sie seien nicht in der Lage, den Sachverhalt zu prüfen, sondern nur, ob das Gesetz korrekt angewandt worden war.
Unter Berufung auf Artikel 6 der MenschenrechtskonventionExterner Link ging Belilos nach Strassburg, und argumentierteExterner Link, dass ihr das Recht auf Anhörung durch eine unabhängige Instanz verwehrt worden sei.
Sie gewann 1988 mit einem Urteil, das laut Evelyne Schmid von der Universität Lausanne «Schockwellen durch das Schweizer Justizsystem sandte».
Wenn man im Jahr 2024 von den Behörden angeklagt wird, scheint es eine Selbstverständlichkeit zu sein, den Sachverhalt vor einem unabhängigen Gericht anfechten zu können.
1988 war dies noch nicht der Fall: Damals wurde im Ständerat ein Postulat auf Austritt aus der Konvention gestellt, der mit einer einzigen Stimme Unterschied äusserst knapp abgelehnt wurde.
1992 – im Namen der Gleichheit

Als Susanna Burghartz 1984 in Deutschland Albert Schnyder heiratete, nahm das Paar ihren Nachnamen als Familiennamen an: Von nun an hiessen sie Susanna Burghartz und Albert Schnyder Burghartz.
In Deutschland war dies rechtens. Doch in Basel, wo sie lebten, waren die Behörden weniger begeistert. Sie bestanden darauf, den Familiennamen als Schnyder einzutragen, und zwangen Albert, den Namen Burghartz abzulegen – nur Frauen dürften Doppelnamen tragen, so die Begründung der Behörden.
Die Richterinnen und Richter in Strassburg waren anderer Meinung: Es gebe keine vernünftige Rechtfertigung für eine Ungleichbehandlung bei Nachnamen, urteilten sie 1992Externer Link. Einige Jahrzehnte später streitet sich die Schweiz immer noch über die Namensregeln.
2011 – die Grenzen des Gerichts, Teil 1

Trotz dieser Beispiele – Erfolge in Strassburg bleiben selten: Die grosse Mehrheit der Klagen (94% der Klagen gegen die Schweiz im Jahr 2023) werden als unzulässig eingestuft oder abgewiesen.
Denn das Gericht hat etwa ein klares Mandat, das die Behandlung abstrakter Klagen gegen allgemeine Gesetze nicht umfasst.
Als eine Gruppe Schweizer Muslim:innen gegen das Minarettverbot von 2009 klagte, verloren sie vor allem deshalb, weil sie nicht nachweisen konnten, dass ihre Menschenrechte direkt betroffen waren.
Sie konnten keine Opferrolle nachweisen. Ein Verbot von Minaretten könnte zwar gegen die Religionsfreiheit (Artikel 9Externer Link) verstossen; aber nur, wenn jemand direkt diskriminiert wird – etwa, wenn die Behörden einen Antrag auf den Bau einer Moschee mit Minarett ablehnen. In diesem Fall könnte er oder sie sich an den EGMR wenden.
2014 – der lange Schatten des Asbests

Im Jahr 2005 starb Hans Moor an Lungenkrebs. Die Ursache der Krankheit war eine Asbestexposition während seines Arbeitslebens, die mehrere Jahrzehnte zurücklag.
Nach seinem Tod setzte seine Frau Renate Howald Moor das Gerichtsverfahren fort, das Hans Moor nach seiner Diagnose angestrengt hatte. Er hatte von seinem früheren Arbeitgeber, dem Eisenbahnhersteller Alstom, Schadensersatz gefordert.
Erfolglos: Die Schweizer Gerichte entschieden, dass nach der letzten Asbestexposition eine zehnjährige Verjährungsfrist gilt.
In Strassburg urteilte der EGMR jedoch, dass eine solche Verjährungsfrist gegen die Rechte von Menschen mit Krankheiten verstösst, die erst Jahrzehnte später diagnostiziert werden können. In solchen Fällen muss die Verjährungsfrist angepasst werden, entschied das Gericht 2014Externer Link.
2024 – die Grenzen des Gerichts, Teil 2

Der Klimawandel ist ein weiteres komplexes Thema, wenn es um «direkte» Auswirkungen geht. Der Planet erwärmt sich allmählich, die Ursachen sind diffus und die Auswirkungen global; im Jargon des Europarats handelt es sich um ein «transversales Thema»Externer Link.
Doch im April 2024, nach der Anhörung der Klage einer Gruppe älterer Schweizerinnen, entschied der EGMR eindeutigExterner Link: Der Schweizer Staat komme seinen internationalen Klimaverpflichtungen nicht nach und habe die Rechte (Artikel 8Externer Link) der klagenden Seniorinnen verletzt, die aufgrund ihres Alters von den Gefahren des Klimawandels besonders betroffen sind.
Das Urteil sorgte weltweit für Schlagzeilen und löste in der Schweiz heftigen Widerstand aus, da es die schwelenden Debatten darüber wieder aufleben liess, wie weit die Befugnisse gehen sollten.
Selbst die Schweizer Behörden zeigten sich von dem Urteil unbeeindruckt. 2025 müssen sie dem Europarat gegenüber nachweisen, dass sie das Urteil umsetzen.
Der Europarat, die Konvention und ihr Gerichtshof
Die Europäische Menschenrechtskonvention, die 1953 in Kraft trat, wurde vom Europarat ausgearbeitet, der nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet worden war.
Ziel der Konvention war und ist es, die Grundrechte und politischen Freiheiten in Europa zu schützen – vom Verbot der Sklaverei bis zur Meinungsfreiheit.
Die Ratifizierung der Konvention ist eine Voraussetzung für den Beitritt zum Europarat mit seinen 46 Mitgliedern.
Die Mitgliedstaaten sind für die Einhaltung der Konvention in ihren nationalen Rechtsordnungen verantwortlich.
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR), der sich aus einem Richter pro Mitgliedstaat zusammensetzt, befasst sich mit Fällen möglicher Verstösse.
Einzelpersonen können solche Fälle in Strassburg vorbringen, nachdem sie alle rechtlichen Möglichkeiten auf nationaler Ebene ausgeschöpft haben.
Die Entscheidungen des EGMR sind verbindlich, und die Umsetzung wird vom Ministerkomitee des Europarats überwacht, das sich aus den Aussenminister:innen der 46 Mitgliedstaaten zusammensetzt.
Zwischen 1959 und 2021 hat der EGMR 24’511 Urteile gefällt. Rund 40% davon betrafen nur drei Länder: Die Türkei, Russland (das 2022 aus dem Europarat ausgeschlossen wurde) und Italien.
Die Richterinnen und Richter stellten in 84% der seit 1959 gefällten Urteile Verstösse fest; gleichzeitig wurden etwa 94% aller Fälle als unzulässig eingestuft oder ohne Urteil verworfen. Der häufigste Verstoss (37%) betraf Artikel 6 der Konvention: das Recht auf ein faires Verfahren.
Editiert von Mark Livingston / ts, Bildrecherche: Helen James, Übertragung aus dem Englischen: Meret Michel / raf

In Übereinstimmung mit den JTI-Standards













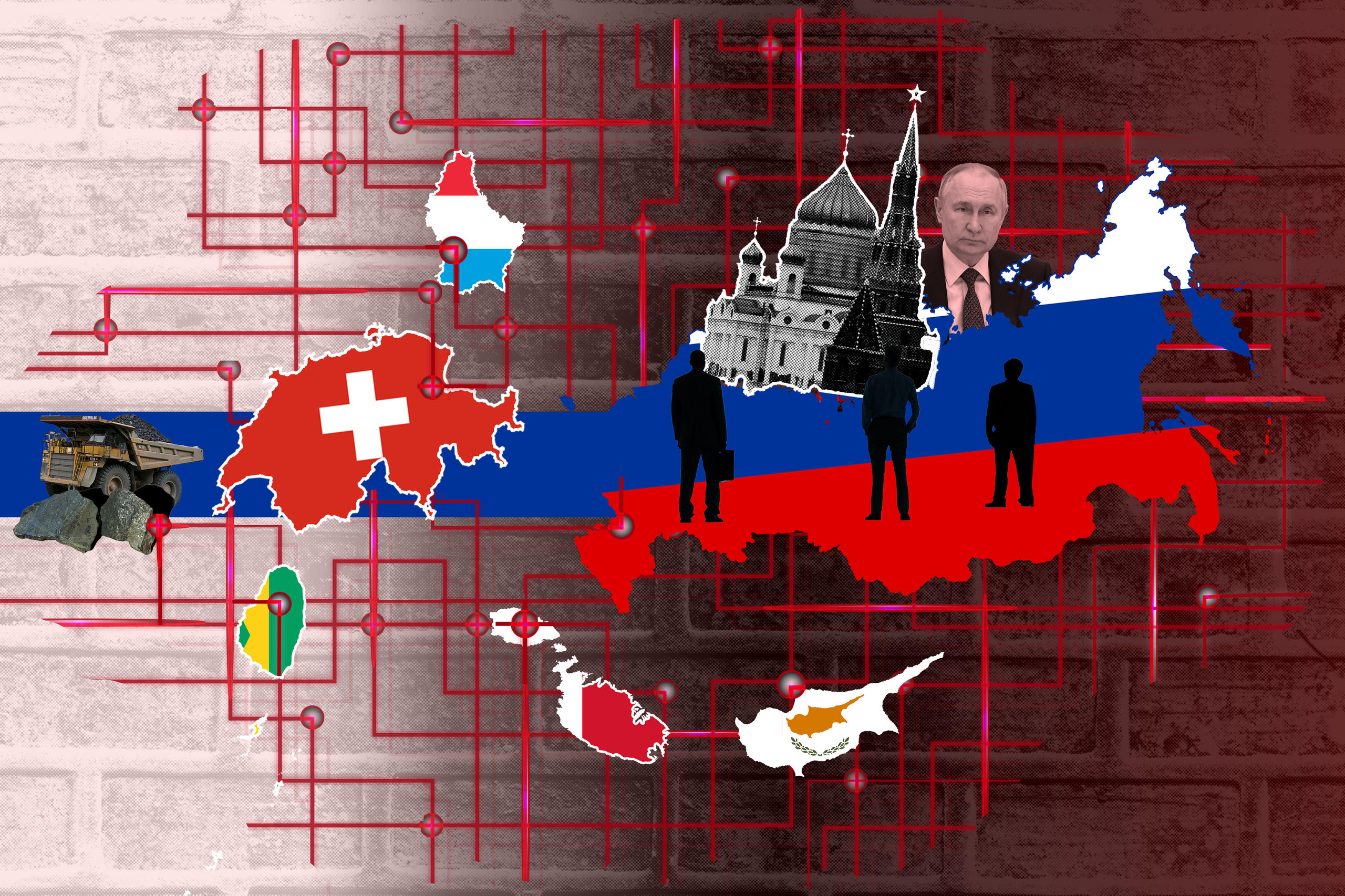

Einen Überblick über die laufenden Debatten mit unseren Journalisten finden Sie hier. Machen Sie mit!
Wenn Sie eine Debatte über ein in diesem Artikel angesprochenes Thema beginnen oder sachliche Fehler melden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an german@swissinfo.ch