«Volksentscheid erleichtert internationale Verhandlungen»

Die direkte Demokratie sorgt in jüngster Zeit in der Schweizer Aussenpolitik öfter für akute Bauchschmerzen. Jüngstes Beispiel: die Umsetzung der Masseinwanderungs-Initiative. Mit Volksentscheiden im Rücken liessen sich am internationalen Verhandlungstisch aber gerade solch schwierige Mandate leichter angehen, sagt Michael Ambühl, Professor für Verhandlungsführung an der ETH Zürich und ex-Spitzendiplomat.
Die Erfahrungen mit direkter Demokratie in der Schweiz zeigen: Sie kann Belastungen gegen innen und Spannungen gegen aussen bedeuten. Das ist spätestens seit der Alpeninitiative bekannt, deren Annahme 1994 mit dem Transitabkommen kollidierte, das die Schweiz mit der EU abgeschlossen hatte.
Hauptforderung der Alpeninitiative war die Verlagerung des Güterverkehrs von der Strasse auf die Schiene. Schweizer Regierung und Parlament haben diesen Verfassungsauftrag nicht buchstabengetreu umgesetzt. Dem Verlagerungsziel wurde dem Sinn nach entsprochen: mit einer Lenkungsabgabe, der «leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe» (LSVA).
Für einen ähnlichen Weg plädiert Michael Ambühl, Professor für Verhandlungsführung an der ETH ZürichExterner Link und ehemaliger Schweizer Unterhändler, bei der Umsetzung der Volksinitiative «gegen Masseneinwanderung», zu der das Schweizer Stimmvolk 2014 Ja sagte.
swissinfo.ch: Was sind Ihre Erfahrungen als langjähriger Unterhändler, mit einem Entscheid des Schweizer Volkes im Rücken an den Verhandlungstisch zu gehen?
Michael Ambühl: Ein schwieriges Verhandlungsmandat ist damit gegenüber den Verhandlungspartnern leichter zu begründen.
Das heisst aber nicht, dass Volksentscheide einem am Verhandlungstisch das Leben grundsätzlich leichter machen. Wenn diese im Widerspruch zum europapolitischen Konzept der Schweizer Regierung und des Parlament stehen, wird es für die Unterhändler nicht leicht. Aber das macht den Job spannend.
Ambühl: «Regierungssystem ausschlaggebender»
Was den Einfluss auf aussenpolitische Verhandlungen betrifft, gebe es zwischen den Systemen direkter und indirekter Demokratie keine so grossen Unterschiede. Dies die Erfahrung des ehemaligen Schweizer Spitzendiplomaten Michael Ambühl.
Ausschlaggebender sei das Regierungssystem und dessen Charakteristiken.
Zu den Punkten, die einen Einfluss auf aussenpolitische Verhandlungen haben, zählt er:
Kollegialitätsprinzip: Kein/e Regierungschef/in und damit eine weniger straff geführte Aussenpolitik in Fällen von Uneinigkeit in der Regierung;
Koalitionsregierung: Oft nur Lösungen auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner;
Dezentrale Entscheidungsstrukturen: Auf Stufen Bund, Kantone und Gemeinden viele unterschiedliche Akteure und Ansichten.
Schweizerische Konsenskultur: steht hartem Auftritt gegen aussen entgegen, auch dem Aushalten von Druck.
«Helvetischer Purismus»: Verhandlung nur in einer Sache, Skepsis gegenüber Verknüpfungen mit andern Verhandlungsgegenständen.
Bescheidenheit: Schweiz tut viel Gutes für die Welt, «verkauft» sich aber oft unter dem Wert.
swissinfo.ch: Ihr Nachfolger, EU-Unterhändler Yves Rossier, steht vor einer schier unlösbaren Aufgabe, denn für Brüssel sind Einwanderungsbeschränkung und freier Personenverkehr unvereinbar. Wie stehen die Chancen?
M.A.: Will man die bilateralen Verträge erhalten, wird eine buchstabengetreue Umsetzung des Verfassungsartikels zur Begrenzung der Einwanderung wohl schwierig sein. Eine solche würde die Einführung von Kontingenten und einen Inländervorrang notwendig machen. Ich glaube aber kaum, dass Brüssel das akzeptieren wird. Die EU hat ihre ablehnende Position vor und nach der Abstimmung wiederholt bekräftigt und dies auch schriftlich festgehalten.
Hingegen wäre zu prüfen, ob man nicht eine Umsetzung anstreben soll, die im Sinn und Geist des neuen Verfassungsartikels ist. Das würde bedeuten, dass die Schweiz die Einwanderungsbeschränkung mittels Kontingenten gegenüber Nicht-EU-Staaten strikt umsetzt. Gegenüber den 28 EU- und den 3 EFTA/EWR- Ländern aber würde sie die Initiative nur sinngemäss umsetzen. Und zwar mit einer Schutzklausel, die das Prinzip der Personenfreizügigkeit nicht verletzt.
Konkret könnte die Schweiz vorschlagen, dass sie gegenüber diesen 31 europäischen Staaten den Grundsatz des freien Personenverkehrs einhält und keine Vorrangregelung einführt. Aber sie würde sich das Recht vorbehalten, dass Bern eine Schutzklausel anrufen darf, sobald die Zuwanderung aus diesen europäischen Staaten einen festgelegten Schwellenwert übersteigt. Eine solche Schutzklausel gab es ja schon im Freizügigkeitsabkommen. Nur ist sie seit dem 31.Mai 2014 nicht mehr gültig. Man müsste sie also «lediglich» erneuern und zugleich auch etwas modifizieren.
swissinfo.ch: Sie haben gesagt, dass die Schweiz schlechte Karten habe, wenn sie fundamentale Prinzipien der EU oder das Völkerrecht an sich angreife. Müsste die Vorprüfung von Volksinitiativen generell ausgeweitet werden, damit die Schweiz bei deren Umsetzung weniger Konflikte riskiert?
M.A.: Ich bin kein Verfassungsrechtler. Aber wenn ich die Debatte über eine solche Vorprüfung richtig verstehe, dann geht es um jene Fälle, bei denen eine Initiative das sogenannt zwingende Völkerrecht verletzt.
Bei der Personenfreizügigkeit handelt es sich nicht um ein solch zwingendes Recht, aber um einen wesentlichen Eckwert in unserem Verhältnis zur EU. Auch die Alpeninitiative – die das Schweizer Stimmvolk 1994 entgegen den Empfehlungen von Regierung und Parlament annahm – stellte keine fundamentalen Völkerrechtsprinzipien in Frage. Dort ging es um Vertragsrecht, genauer um das Transitabkommen, das die Schweiz mit der EU abgeschlossen hatte. Die Annahme der Alpeninitiative bedeutete eine Kollision mit diesem Transitabkommen, aber die Lösung war eine nicht buchstabengetreu Umsetzung, womit der Konflikt gelöst werden konnte
Die Möglichkeit der Kündigung ist meistens Teil eines Vertrags. Wenn mit einem Volksentscheid die Kündigung eines Vertrages verlangt wird, heisst das noch nicht, dass Völkerrecht verletzt wird. Dies ist also rechtlich möglich, was aber nicht heisst, dass die Kündigung dann nicht andere Probleme mit sich bringt.
Ex-Spitzendiplomat
Der 63-jährige Michael Ambühl ist heute Professor für Verhandlungsführung an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich (ETH).
Als Chefunterhändler war er für die Schweiz u. a. bei den Bilateralen II mit der EU beteiligt.
In den Verhandlungen zur Beilegung des Steuerstreites mit den USA führte Ambühl die Schweizer Delegation als Staatssekretär an.
swissinfo.ch: Sie wünschen sich eine Stärkung der Sensibilisierung für Aussenpolitik bei der Verwaltung sowie den innen- und aussenpolitischen Akteuren generell. Kürzlich wurde eine «Swiss School of Public Governance» vorgeschlagen. Was genau erhoffen Sie sich davon?
M.A.: Man könnte sich für eine solche «Schweizer Schule für gute Regierungsführung» von ausländischen Vorbildern inspirieren lassen. Etwa von der Harvard School in den USA oder von Schulen in Frankreich. Es geht aber nicht darum, diese Beispiele eins zu eins zu kopieren, denn diese Länder haben andere Vorstellungen von Politik und andere aussenpolitische Traditionen.
Was uns vorschwebt, sind Lehrgänge für Kader der Verwaltung bei Bund, Kantonen und Städten. Angesprochen wären aber auch Mitarbeiter von Unternehmen mit ausgeprägter internationaler Ausrichtung. Das könnten sowohl bundesnahe, wie beispielsweise die SBB oder die Swisscom, als auch privatwirtschaftliche Betriebe sein. Zielpublikum wäre in erster Linie Personal mit höheren Management-Ambitionen.
Der Lehrgang wäre nicht als eigenständiges Masterprogramm einer Universität gedacht, sondern als berufsbegleitende Zusatzausbildung. Dieses Modul müsste aber ein möglichst kohärentes Ausbildungsprogramm offerieren, statt nur Puzzle-artige Bruchstücke, zu vermitteln.

In Übereinstimmung mit den JTI-Standards


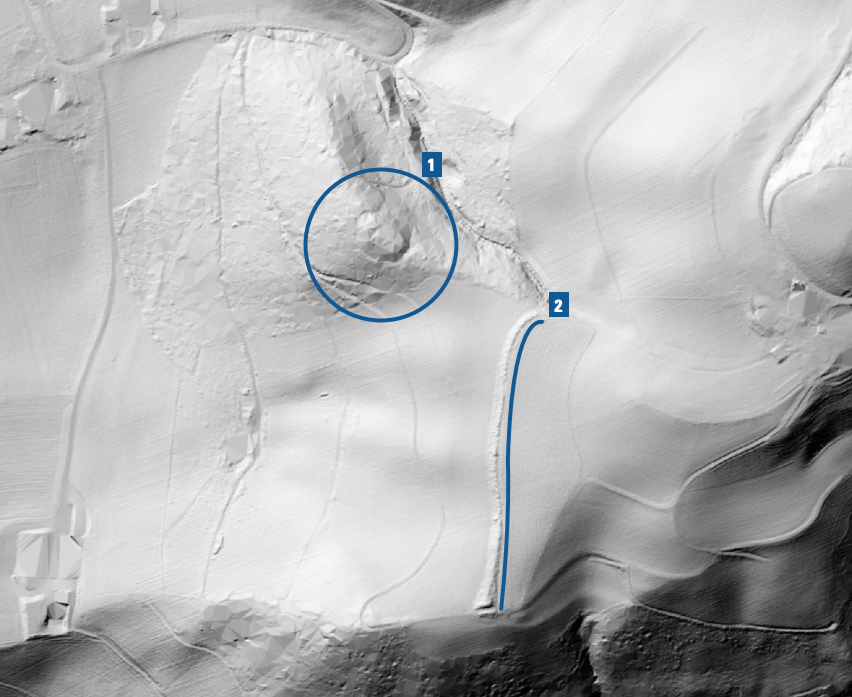













Einen Überblick über die laufenden Debatten mit unseren Journalisten finden Sie hier. Machen Sie mit!
Wenn Sie eine Debatte über ein in diesem Artikel angesprochenes Thema beginnen oder sachliche Fehler melden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an german@swissinfo.ch