Geistige Landesverteidigung 2.0? Wie die Schweiz und andere Länder mit Desinformation umgehen

Die Schweizer Regierung ist besorgt wegen Desinformation und Beeinflussung «in der Grauzone» zwischen Krieg und Frieden. Wie begegnet das Land den Gefahren hybrider Kriegsführung – und was tun Schweden, und Frankreich, Grossbritannien?
«To be Switzerland» ist eine Redewendung dafür, sich nicht einzumischen, im Kleinen und Grossen. Viele, in der Schweiz und ausserhalb, haben das Gefühl, die Schweiz könne sich aus allem raushalten.
Doch die Weltlage hat sich geändert – selbst für das kleine, neutralen Land in Europas Mitte.

Mehr
Ex-US-General rät der Schweiz zur Kriegsvorbereitung
Neben konventionellen Bedrohungen stehen auch Mittel «in der Grauzone zwischen bewaffnetem Konflikt und Frieden» im Fokus, wie es in einem Bericht der Schweizer RegierungExterner Link heisst.
Desinformation und Beeinflussung richteten sich «zunehmend direkt auf die Schweiz». «Beeinflussungsakteure» könnten im Feld der Aussenpolitik und auf die Schweiz als Sitz internationaler Organisationen einwirken.
Volksabstimmungen als Ziel von Desinformation in einem Informationskrieg?
Oder sie zielen auf die direkte Demokratie. «Offene, demokratische Gesellschaften können lohnende Ziele sein, um auf deren freie Debatten und demokratische Prozesse Einfluss zu nehmen», stellt der Bericht generell fest.
In der Schweiz biete das «direktdemokratische System, wo die Bevölkerung regelmässig politische Entscheide fällt» einige «potenzielle gesellschaftliche und politische Bruchlinien».

Mehr
Die Schweiz in den Fängen der russischen Propagandamaschine
Die Bedenken vor einem Informationskrieg sind auch im Parlament angekommen, wo man bald über mehrere Motionen zum Thema Desinformation und Beeinflussung entscheidet.
Es geht um eine Koordinationsstelle zur Bekämpfung von DesinformationExterner Link und eine mögliche Bewerbung auf Beobachterstatus im G7 Rapid Response MechanismExterner Link (G7 RRM). Die Regierung empfiehlt die Parlamentsvorschläge anzunehmen.
Der G7 RRM ist ein Ansatz, der Problematik international abgestimmt zu begegnen. Dies ist eine von Kanada geführte Koordinationsstelle der G7-Länder, um «vielfältigen und sich wandelnden ausländischen Bedrohungen für die Demokratie» zu begegnen, wie die Pressestelle auf Anfrage schreibt. Die Chancen einer möglichen Schweizer Bewerbung könne man nicht kommentieren.
Desinformation habe zum Ziel, dass die Bevölkerung «verunsichert, verängstigt, aufgebracht oder gespalten» wird, heisst es im Regierungsbericht.
Nicht zwingend müsse die in Umlauf gebrachte Desinformation überzeugen: Oftmals wiederholten Aussagen werde eher geglaubt, selbst wenn eigentlich bekannt ist, dass es sich um Falschdarstellungen handelt.
China und Russland haben «grösste Relevanz für die Sicherheit»
Im Fokus der Sorge steht dabei für die Schweizer Regierung Russland und China: Diese haben laut Bericht die «grösste Relevanz für die Sicherheit der Schweiz».
Doch auf hybride Kriegsmittel zu antworten, ist herausfordernd für liberale Demokratien wie die Schweiz.
Denn Regierungen sollten nicht die Akteure sein, die entscheiden, was wahr und was falsch sei. «Sobald Regierungen involviert sind, wird es politisiert», sagte der Spionage- und Sicherheitsexperte Rory Cormac 2024 bei einer Anhörung im britischen Parlament.
Gleichzeitig betonte Cormac dort, dass die ausländischen Mächte nicht nur auf direkte Kanäle setzen, sondern auf Netze aus auf den ersten Blick unverdächtigen Organisationen und Individuen.
Mitverantwortung der Parteien und Politiker:innen im Land
Gegenüber SWI Swissinfo.ch schildert Cormac, dass Desinformation das «Vertrauen in Institutionen, Medien und Demokratie» untergrabe und «schädlich und allgegenwärtig» sei.
Der Professor an der Universität Nottingham macht klar, dass es auch von der Politik im Inland abhängt, ob ausländische Beeinflussung ihr Ziel erreicht.
Desinformation, so Cormac, gedeihe in einer Atmosphäre «toxischer politischer Debatten mit wenig Beachtung von Fakten». Wie diese Kultur aussieht, liege in den Händen der inländischen politischen Akteure.
Die britischen Wahlen 2024 nahm Cormac im Vergleich zu 2019 grundsätzlich als positiv wahr. «Ich denke, die Kandidierenden 2024 waren weniger anfällig für das «Postfaktische» als 2019, vor allem weil [Boris] Johnson nicht mehr da war.» Aber die Konservativen hätten im Wahlkampf «ihren 2019-Trick» wiederholt: Ihren Twitter-Auftritt so anzupassen, dass er den «irreführenden Eindruck» machte, es sei ein «unabhängiger Fact-Checking-Account». «Das war völlig verantwortungslos», findet Cormac.

Die Schweizer Bedrohungslage kommentiert Cormac nicht. Doch für Grossbritannien – Nicht-EU-Mitglied wie die Schweiz – erkennt er die Wichtigkeit einer «engen Beziehung mit Europäischen Partnern».
Ein Beispiel, an dem sich Länder wie Grossbritannien orientieren könnte, sind für Cormac die baltischen und skandinavischen Staaten. «Finnland, beispielsweise, betont Medienkompetenz und hat hohes Vertrauen in sein öffentliches Medienhaus», findet Cormac, der sagt, dass Medienkompetenz «eine klare Sicherheitsdimension» hat. Sie baue demokratische Resilienz auf.
Cormac schätzt den G7 RRM, wo Grossbritannien als G7-Land dabei ist, als Koalition gegen Desinformation grundsätzlich. So könne man «versuchen feindseligen oder falschen Narrativen schnell zuvorzukommen, wenn nötig».
Angesichts des «jüngsten Verhaltens der US-Regierung» erwartet er «Aufruhr» im G7 RRM. «Es ist schwierig, auf Desinformation zu reagieren, wenn ein G7-Mitglied derzeit falsche Narrative verbreitet», findet Cormac.
«Wir haben den wichtigsten Verbündeten verloren»
Auch in der Schweiz – wo die Regierung auf konstruktive Zusammenarbeit mit den USA hofft, gibt es Stimmen, die die Bedrohungslage angesichts der neuen US-Regierungslage neu einschätzen.
«Wir haben den wichtigsten Verbündeten in Europa verloren. Wir stehen allein da», sagt Olga Baranova zu SWI. Es sei ein «absoluter Umbruch», auch die Schweiz müsse nun die liberale Demokratie aktiv verteidigen.
Baranova ist Geschäftsführerin des politisch progressiven Schweizer Thinktanks CH++. Sie sieht es nun drängend, dass die Schweiz sich um ihre Sicherheit, im ganzheitlichen Sinne, bemüht: CH++ setzt sich für eine verantwortungsvolle Digitalisierung ein und einen «erweiterten Sicherheitsbegriff» ein.
Ende Februar hat sie vor einem vollen Saal über ein Thema gesprochen, das im ersten Moment eher nach Vergangenheit als nach Zukunft klang: Baranova fordert die Debatte zu einer Geistigen Landesverteidigung 2.0.
Mehr
Eine «Geistige Landesverteidigung 2.0» für die Schweiz?
«Die Geistige Landesverteidigung war kein Programm für friedliche Zeiten», sagt Baranova, «sondern ein Programm für kriegerische Zeiten wie jetzt.» Die Geistige Landesverteidigung war ein Leitmotiv der Schweizer Politik von den 1930er- bis 1960er-Jahren, das zwiespältig in Erinnerung bleibt. Es sollte den nationalen Zusammenhalt stärken, als die Sprachregionen in der Zwischenkriegszeit auseinanderzudriften drohten.
In dieser Lage wollte man die nationale Erzählung der Schweiz stärken. «Man sagte zu Beginn der Geistigen Landesverteidigung: ‘Was die Schweiz ausmacht, ist wichtig und daran arbeiten wir jetzt.’ Man hat aber gleichzeitig gar nicht formuliert, was die Schweiz ausmacht», erklärt Baranova. Dies sei ein «absoluter Geniestreich» gewesen.
Die Geistige Landesverteidigung brachte der Schweiz in den 1930er-Jahren den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und die Kulturstiftung Pro Helvetia, betont Baranova. Heute ist sie aber vielen vor allem wegen der Überwachung von Oppositionellen im Kalten Krieg in Erinnerung, im Rahmen der sogenannten «Fichenaffäre».
Baranova hofft eine Wiederauflage der Geistigen Landesverteidigung, die «von unten», aus der Zivilgesellschaft komme, würde solche Auswüchse verhindern.
Man solle die «Informationsgesellschaft» verteidigen und «Demokratieresilienz» herstellen, Rituale schaffen, die das Land verbinden.
Von staatlicher Seite gelte es mit Fokus auf die Cyberabwehr in die Verteidigung zu investieren. Vor allem fordert Baranova, dass die gemeinsame Erzählung der Schweiz diskutiert und geprägt werden soll.

Schweden: Gemeinsame Erzählung und «Agentur für psychologische Verteidigung»
«Willensnation», «Vielfalt», «Haltung», «wehrhafte Demokratie»: Beim Zuhören fallen einem Baranovas grosse Worte auf. Doch können gemeinsame Geschichten und gemeinsame Identität Teil eines Sicherheitskonzepts im 21. Jahrhundert sein?
Wenn man Leon Erlenhorst folgt, schon. Erlenhorst ist Politikwissenschaftler und Co-Autor des Buchs «Putins Angriff auf Deutschland: Desinformation, Propaganda, Cyberattacken».
Das Buch bietet eine Übersicht über die Ansätze verschiedener europäischer Länder im Umgang mit der veränderten Bedrohungslage.
Im Gespräch mit SWI hebt Erlenhorst Schweden als positives Beispiel hervor: «Schweden reagiert bemerkenswert auf die Bedrohung durch Desinformation, weil ein holistischer Ansatz verfolgt wird.» Dazu gehöre, im Rahmen der «Resilienzsteigerung» auch «die Erzählung von sich selbst als starker Demokratie».
Natürliche reichen Narrative allein nicht. Das Land setzt auch auf Monitoring, auf Bildungsangebote, die über Künstliche Intelligenz aufklären und Medienkompetenz stärken – und auf «eventuelle Gegenmassnahmen».
«Denkbar seien da gemäss einem Verantwortlichen etwa die Ausschaltung von Servern über die Desinformation verbreitet werde mit militärischen Mitteln», erklärt Erlenhorst.
Viginum in Frankreich
In Frankreich gibt es die Organisation «Viginum», die selbst keine offensive Gegenmassnahmen veranlassen kann. «Die Aufgabe von Viginum, seit 2021 ist das Aufspüren manipulativer Aktivitäten. Frankreich ist dann auch nicht schüchtern, kundzutun, wenn es eine grosse Desinformationskampagne entdeckt hat», führt Erlenhorst aus. Viginum arbeitet nicht wie ein Geheimdienst. Man hat einzig Zugriff auf öffentliche Quellen, um Muster zu dokumentieren und zu analysieren. Die Daten werden anonymisiert verwendet. Doch ab wann gefährden solche Massnahmen die Freiheit der Bürger:innen?
«Was für eine Schweizer Frage, aber eine wichtige», sagt Erlenhorst. Es sei ein sensibler Bereich und immer eine Abwägung. «Ich denke, es ist ein sehr geringer Preis, wenn man anonymisierte, öffentlich-zugängliche Daten nutzt, um zu verhindern, dass die Informationsgrundlagen von Bürger:innen von ausländischen Akteuren manipuliert werden.»
Desinformation zielt auf «länderspezifische Bruchlinien»
Als Leitlinie für Strategien gegen ausländische Beeinflussung ist für Erlenhorst das sogenannte Pre-Bunking entscheidend.
Man könne Falschinhalte richtigstellen, aber besser als die Reaktion sei pro-aktives Handeln. Erlenhorst gibt ein international verständliches Beispiel dafür: «Wenn man von Anfang alle Informationen zu Wirkung und Risiken eines Impfstoffs zusammenfasst und veröffentlicht».
Begegnen Bürger:innen erst danach zweifelhaften Informationen, glauben sie der Zweitinformation seltener – als wenn sie noch nie vom Thema gehört haben.

Mehr
Zwischen Fake News und Fakten: Die Verantwortung der internationalen Medien
Erlenhorst schätzt internationale Projekte zum Bekämpfen von Desinformation. Teilweise könne die Antwort nur international sein. Als Beispiel nennt er die Massnahmen der EU, um die grossen Sozialen Medien zu regulieren.
Trotzdem findet er es wichtig, dass sich jedes Land für sich auseinandersetzt, wie es ausländischer Einflussnahme begegnet. «Desinformationskampagnen zielen immer auf länderspezifische Bruchlinien ab», sagt Erlenhorst.
In der Schweiz hat diese Auseinandersetzung erst begonnen.

Mehr
Unser Demokratie-Newsletter
Editiert von David Eugster

In Übereinstimmung mit den JTI-Standards






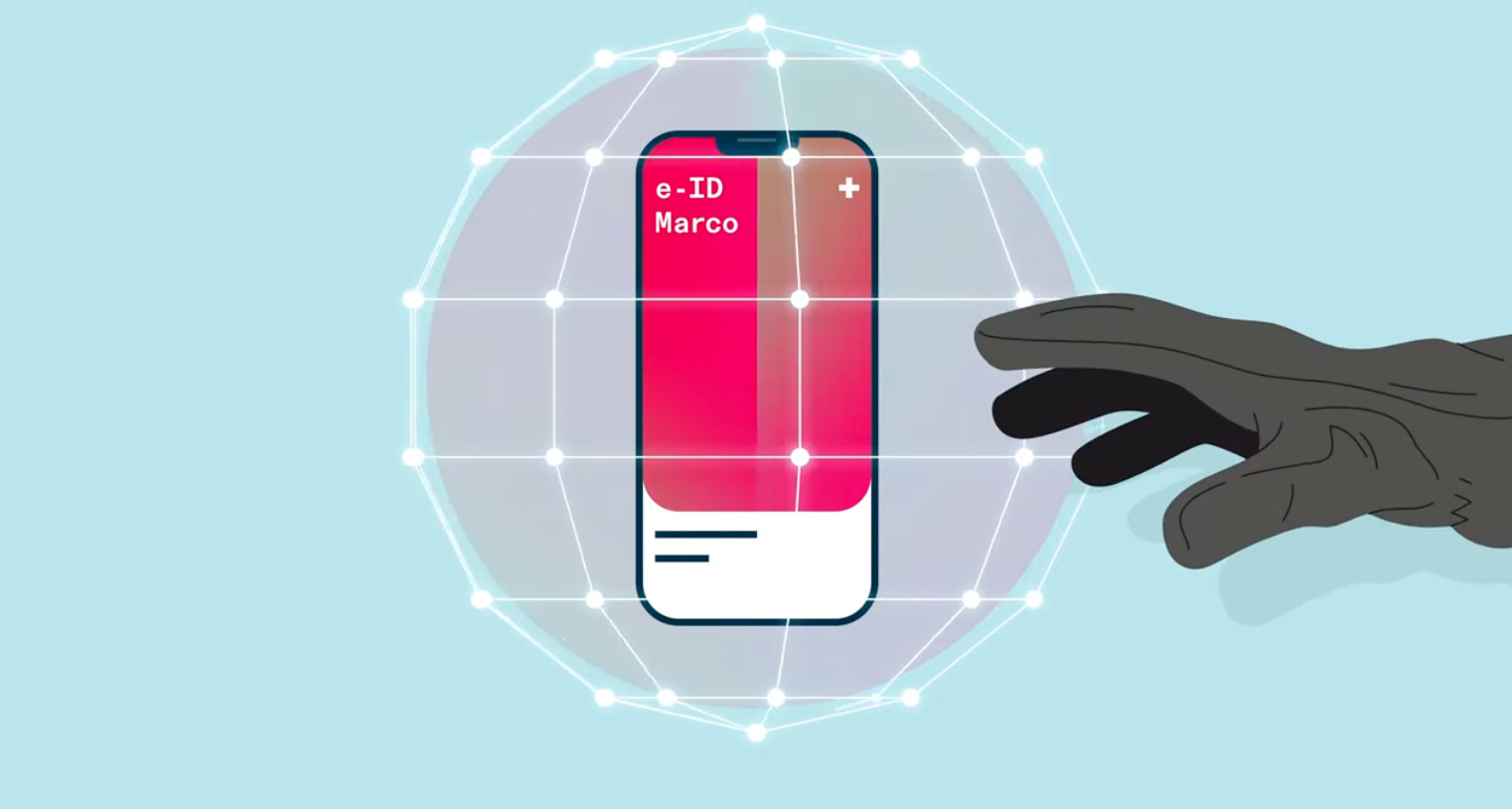







Einen Überblick über die laufenden Debatten mit unseren Journalisten finden Sie hier. Machen Sie mit!
Wenn Sie eine Debatte über ein in diesem Artikel angesprochenes Thema beginnen oder sachliche Fehler melden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an german@swissinfo.ch