
Vor den Europawahlen: «Seit dem Brexit kann die Schweiz nicht mehr Rosinen picken»

Der Politikwissenschaftler Giorgio Malet hat erforscht, wie sich der Brexit auf EU-Austrittsgelüste in anderen Ländern auswirkt. Im Interview spricht Malet auch über die bevorstehenden Europawahlen, den Höhenflug der radikalen Rechten und die bilateralen Beziehungen mit der Schweiz.
Es tönt einleuchtend: Als der Brexit wie ein Erfolgsprojekt aussah, liebäugelten auch mehr Menschen in anderen Ländern der Europäischen Union mit einem Austritt. Seither hat sich das geändert. Giorgio Malet hat diesen Zusammenhang erforscht.
Der Politikwissenschaftler befasst sich an der ETH Zürich mit europäischer Politik und demokratischer Repräsentation.
Im Interview schildert Malet auch seine Perspektive auf die EU-Debatte in der Schweiz und seine Erwartungen für die Europawahlen.
SWI Swissinfo.ch: Sie haben, zusammen mit Stefanie Walter, erforscht, wie Entwicklungen in der britischen Politik während dem Brexit die Sympathien für einen EU-AustrittExterner Link in anderen Ländern prägten. Wann war der Austritt aus der Europäischen Union das letzte Mal im Trend?

Giorgio Malet: Unmittelbar nach dem Brexit. Damals forderten viele andere Parteien in ganz Europa eine ähnliche Initiative zum Austritt ihres Landes aus der Europäischen Union. Aber die Austrittsbefürwortenden haben dann an Schwung verloren.
Der Nachhall des Brexits wurde ein anderer. Wir sahen, dass die Verhandlungen für die britische Seite nicht sehr gut liefen und gleichzeitig die EU im übrigen Europa populärer wurde.
SWI: Die meisten Menschen in Europa haben die Brexit-Verhandlungen nicht so genau verfolgt. Wie kommt es, dass es trotzdem diese Verbindung gibt?
GM: Wir glauben, die Leute schauten nicht auf die Ausarbeitung der Gesetze, sondern auf das politische Geschehen. Wie wir in unserer Analyse zeigen konnten, schafften es bestimmte Ereignisse aus der britischen Innenpolitik in die internationalen Nachrichten.
Dies hatte Auswirkungen auf die Sympathien gegenüber der EU. Die Bevölkerung im übrigen Europa wurde zum Beispiel weniger euroskeptisch, als die Regierung der damaligen britischen Premierministerin Theresa May eine Parlamentsabstimmung über das Brexit-Abkommen verlor.

Die Auswirkungen sind in der Regel gering, aber sie haben eine kumulative Wirkung: Ein Misserfolg nach dem anderen führte zu einem Meinungsumschwung. Die britische Innenpolitik signalisierte den europäischen Wählern, dass das Umsetzen eines EU-Austritts schwierig ist.
SWI: Schauen Wähler:innen auch bei anderen Themen auf die innenpolitische Entwicklung im Ausland?
GM: Das passiert mehr und mehr. Sobald es ausländische Ereignisse in die Nachrichten schaffen. Erlebt man beispielsweise eine Wirtschaftskrise, tendiert man zu mehr Nachsicht gegenüber der eigenen Regierung, wenn man sieht, dass andere Länder auch in Krise sind.
Es gibt weitere Beispiele, in denen dies untersucht wurde, zum Beispiel eine Studie, die zeigt, wie sich Volksabstimmungen zu Migrationsthemen in der Schweiz auf die Medienberichterstattung über Zuwanderung in Deutschland auswirken. Und es gab eine Arbeit, die zeigte, wie nach der Wahl von Donald Trump offener Rassismus in Europa zugenommen hat. Manche hatten das Gefühl ihren latenten Rassismus nicht mehr verstecken zu müssen.
SWI: Funktioniert das auch in Bezug auf politische Beliebtheit? Wenn die ultrarechte Regierung von Giorgia Meloni in Italien als erfolgreich gezeigt wird, hat das Auswirkungen auf die Bereitschaft in Frankreich den Rassemblement National zu wählen?
GM: Zu kurzfristigen Ansteckungseffekten kann es nach überraschenden Wahlen und Volksabstimmungen kommen. Etwa nach dem Erfolg des Referendums gegen die europäische Verfassung in FrankreichExterner Link: Danach nahm die Unterstützung für die Verfassung auch in anderen Ländern ab.
SWI: Sie sind Teil des Forschungsprojekts DisintegrationExterner Link. Sie erforschen, wie der Austritt von Grossbritannien aus der EU vonstatten geht und ob die Schweizer:innen ihre Beziehungen zur EU kappen wollen. Doch die Schweiz ist ein anderer Fall. Sie ist der EU nie beigetreten – dann hat sie wohl auch weniger Verflechtungen und Verstrickungen.
GM: Bei den Brexit-Verhandlungen wollten die EU-Regierungen ein Exempel setzen, um zu zeigen, dass man nicht einfach aus der EU austreten und dann Rosinen picken kann. Die Schweizer Verhandler:innen erlebten nach dem Brexit sehr viel härtere Gegenüber auf Seite der EU.
Die Schweiz ist zwar kein Mitgliedstaat, aber sie ist voll in die EU integriert. In Bereichen wie dem Schengen-Abkommen ist die Schweiz mehr Teil der EU, als es Grossbritannien je war.

Die EU hat der Schweiz deutlich zu verstehen gegeben, dass es mit dem Rosinenpicken vorbei ist. Die Aushöhlung der aktuellen bilateralen Verträge wird langfristig dazu führen, dass sich die Beziehungen zwischen der Schweiz und der EU verschlechtern.
Das wird sich auf die Medtech-Industrie und den Energiesektor auswirken, wie es bereits jetzt bei den Universitäten passiert. Die Schweiz muss sich also fragen, wo sie in 30 Jahren stehen will – in einer Welt, wo gegenseitige Abhängigkeiten mehr werden.
SWI: Zumindest der öffentlichen Meinung nach ist die Schweiz aber nicht für mehr europäische Integration.
GM: Zunächst einmal ist die Berichterstattung über die Beziehungen der Schweiz zur EU – und zur EU im Allgemeinen – in der Schweizer Debatte sehr gering. Ich war überrascht, als ich aus Italien hierherkam, dass ein so wichtiges Thema kaum diskutiert wird. Die Berichterstattung, die es gibt, behandelt die EU meist auf negative Weise. Sie ist sehr gefärbt und voreingenommen – möglicherweise, weil dies Aufmerksamkeit garantiert.
Die Folge davon ist, dass es in den Schweizer Debatten lange Zeit keine Pro-EU-Stimmen gab. Abgesehen von der Operation Libero melden sich nur Wenige zu Wort. Die meisten haben Angst zu sagen, was sie denken.
SWI: Sagen Ihnen diese Leute das? Oder woher wissen Sie das?
GM: Das ist meine Beobachtung und mein Eindruck. Dabei werden Politiker:innen nicht nur gewählt, um auf die Forderungen ihrer Wähler:innen einzugehen. Sie haben in die andere Richtung auch eine Pflicht, die Wähler:innen von einer bestimmten Politik, an die sie glauben, zu überzeugen. Zum Beispiel eine starke Zusammenarbeit mit der EU.

SWI: Was hätte die Schweiz denn von einer stärkeren europäischen Integration?
GM: Die Schweiz ist in vielerlei Hinsicht schon stark integriert, und wenn sich die Beziehungen zur EU verschlechtern, hat sie etwas zu verlieren. Darum geht es mir.
SWI: Wer gegen eine Annäherung an die EU ist, wie die SVP, sagt eben das Gleiche: Die Schweiz ist schon so stark integriert. Die Befürchtung ist, dass die Schweiz durch eine Hintertür in die EU kommt.
GM: Der Punkt ist der: Die EU hat viele Partner. Sie muss sich gemeinsam auf Regeln einigen und dann müssen alle dieselben Regeln einhalten. Die Schweiz möchte sich die Option offen lassen, bei jedem einzelnen Thema Nein zu sagen – doch so funktioniert internationale Zusammenarbeit nicht.
Da braucht es Vereinbarungen über mehrere Ebenen und Themen hinweg. Ausserdem ist es bereits so, dass die Schweiz in Handelsfragen viele Vorschriften akzeptieren muss – ohne bei der Politikgestaltung der EU mitreden zu können.
SWI: Am 6. Juni starten die Wahlen zum Europäischen Parlament. Im Aufwind sind rechtspopulistische Parteien, die auch für ihre Länder die Rosinen herauspicken wollen. Wird sich die Europäische Union nach dieser Wahl verändern?
GM: Viel wird sich nicht ändern. Die radikale Rechte hat sich von einer EU-skeptischen Haltung in eine kritische Position entwickelt. Einen EU-Austritt würde sie nicht mehr fordern, denn es wurde erkannt, dass man mit dieser Strategie nicht gewinnt. In Ländern wie Italien bilden sie ja die Regierung.

SWI: Aber zum Beispiel die AfD in Deutschland scheint nicht gemässigter zu werden.
GM: Doch nicht alle radikal rechten Parteien sind wie die AfD. Entscheidend ist: Innerhalb der radikalen Rechten gibt es auch immer noch eine starke Spaltung. Sie verteilen sich im Europäischen Parlament auf zwei Fraktionen.
SWI: Was erwarten Sie von den Europawahlen?
GM: Die meisten Simulationen zeigen im Moment, dass die radikale Rechte netto gewinnt. Die Sozialdemokraten, Liberalen und die Linke verlieren wohl einige Sitze. Bei den Konservativen wird erwartet, dass sie stabil bleiben.
SWI: Wenn die radikale Rechte die Wahl gewinnt, wird sie also nicht mit der Dekonstruktion der EU beginnen?
GM: Das werden sie nicht können, denn die Regierungskoalition aus den Konservativen [in der Europäischen Volkspartei], Sozialdemokraten und Liberalen wird höchstwahrscheinlich bleiben.
Politisch wird es Auswirkungen auf die Einwanderungs- und Umweltpolitik geben – schon jetzt blockieren radikale Rechte und Konservative zusammen Dinge wie den European Green Deal. Wahrscheinlich werden sich die Konservativen intern weiter spalten: Zwischen jenen, die offen für eine Zusammenarbeit mit der radikalen Rechten sind, und jenen, die diese isolieren wollen.

SWI: Alles in allem scheinen Sie Stabilität zu erwarten.
GM: Ob ich von Stabilität sprechen möchte, weiss ich nicht. Aber weitergehen wird es.
Die Art, wie sich die europäische Integration in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat, offenbart ein Muster des failing forward, des Vorwärtsscheiterns: Man hat eine Krise. Die Regierungen einigen sich auf eine Lösung. Die Regierungen haben unterschiedliche Präferenzen und unterschiedliche nationale Situationen – also einigen sie sich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner. Es ist nie eine perfekte Lösung, aber es geht stetig ein Stückchen vorwärts.
Nachdem eine Einigung gefunden wurde, führt die Unvollständigkeit der Lösung früher oder später zu einer weiteren Krise.
SWI: Gibt es dieses Muster nur in der EU?
GM: Es ist insofern einzigartig, weil die EU die fortschrittlichste Form der internationalen Zusammenarbeit ist.
Langfristig betrachtet ist es beeindruckend, was Europa erreicht hat: eine massive Integration. Souveräne Staaten haben sich in relativ kurzer Zeit darauf geeinigt, Kompetenzen an eine supranationale Institution abzugeben. Es zeigt sich, dass sich jüngere Menschen viel europäischer fühlen als ältere.
Man kann die Identität der Menschen nicht innert einer Woche oder zehn Jahren ändern. Grosse – meist gut ausgebildete – Teile der Bevölkerung geniessen die Vorteile der europäischen Integration: Leben, Arbeiten, Studieren, Wirtschaften im Ausland. Dies ist die langfristige Perspektive.
Kurz- und mittelfristig untergräbt dieses Muster des Scheiterns – das Balancieren von Krise zu Krise – die Wirtschaftsleistung der EU und ihre Legitimität in der Bevölkerung.
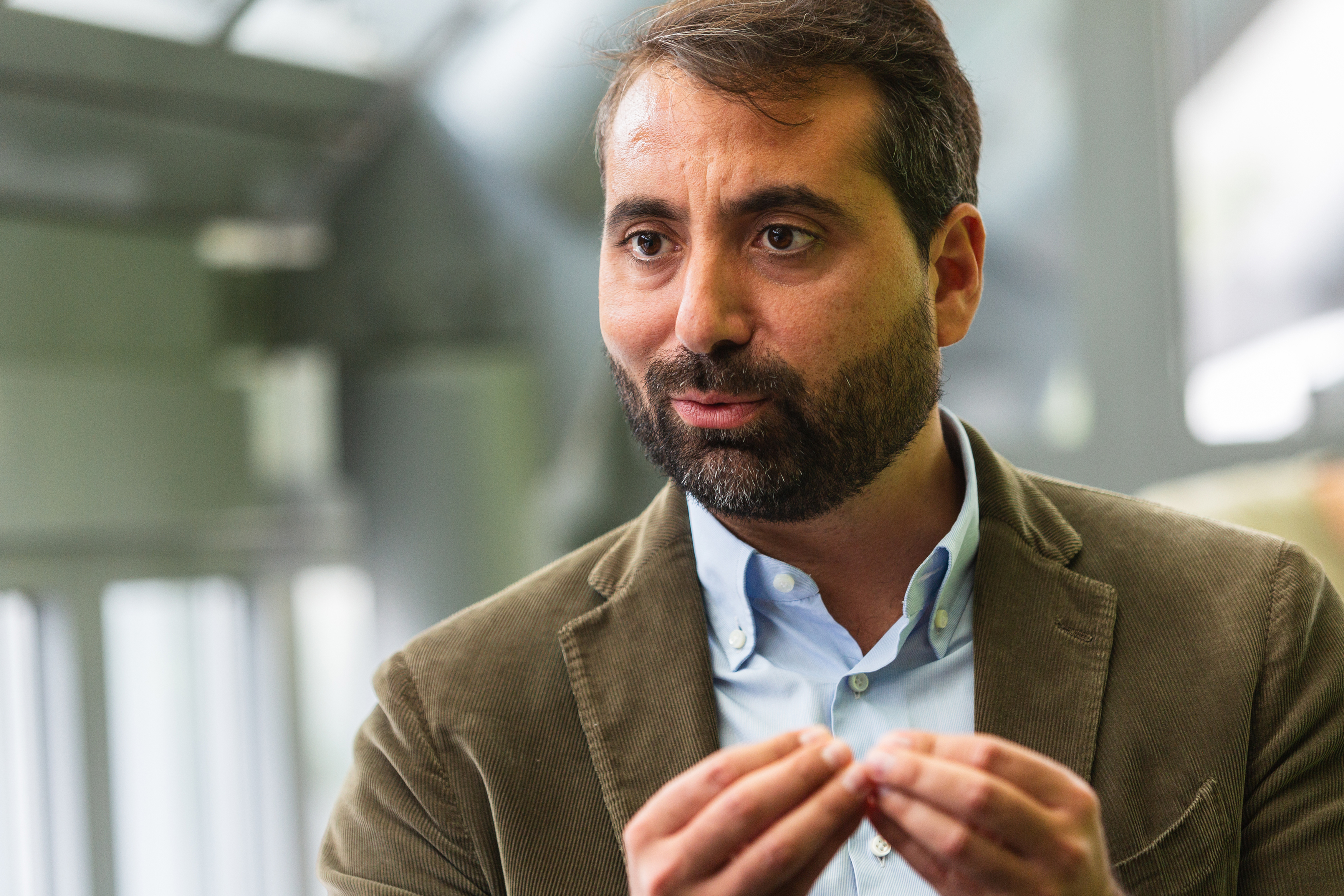
SWI: Und wie kommt die EU aus diesem Teufelskreis?
GM: Das ist wirklich schwer. Innerhalb der EU hat jedes Land bei jeder Entscheidung das Vetorecht.
Ein Ansatz wäre, ein Europa der verschiedenen Geschwindigkeiten: Die Länder, die sich für eine stärkere Zusammenarbeit entscheiden, sollten sich zusammenschliessen und mit diesen Ländern weitermachen. Es wäre nicht das erste Mal, dass Europa das tut – aber es ist an der Zeit, diesen Prozess vorwärtszubringen.

Mehr
Warum die Schweiz nicht in die EU will
Editiert von David Eugster

In Übereinstimmung mit den JTI-Standards



























Einen Überblick über die laufenden Debatten mit unseren Journalisten finden Sie hier. Machen Sie mit!
Wenn Sie eine Debatte über ein in diesem Artikel angesprochenes Thema beginnen oder sachliche Fehler melden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an german@swissinfo.ch