Einsamkeit und weniger Stoff: Alltag der Drogenabhängigen verschlechtert sich
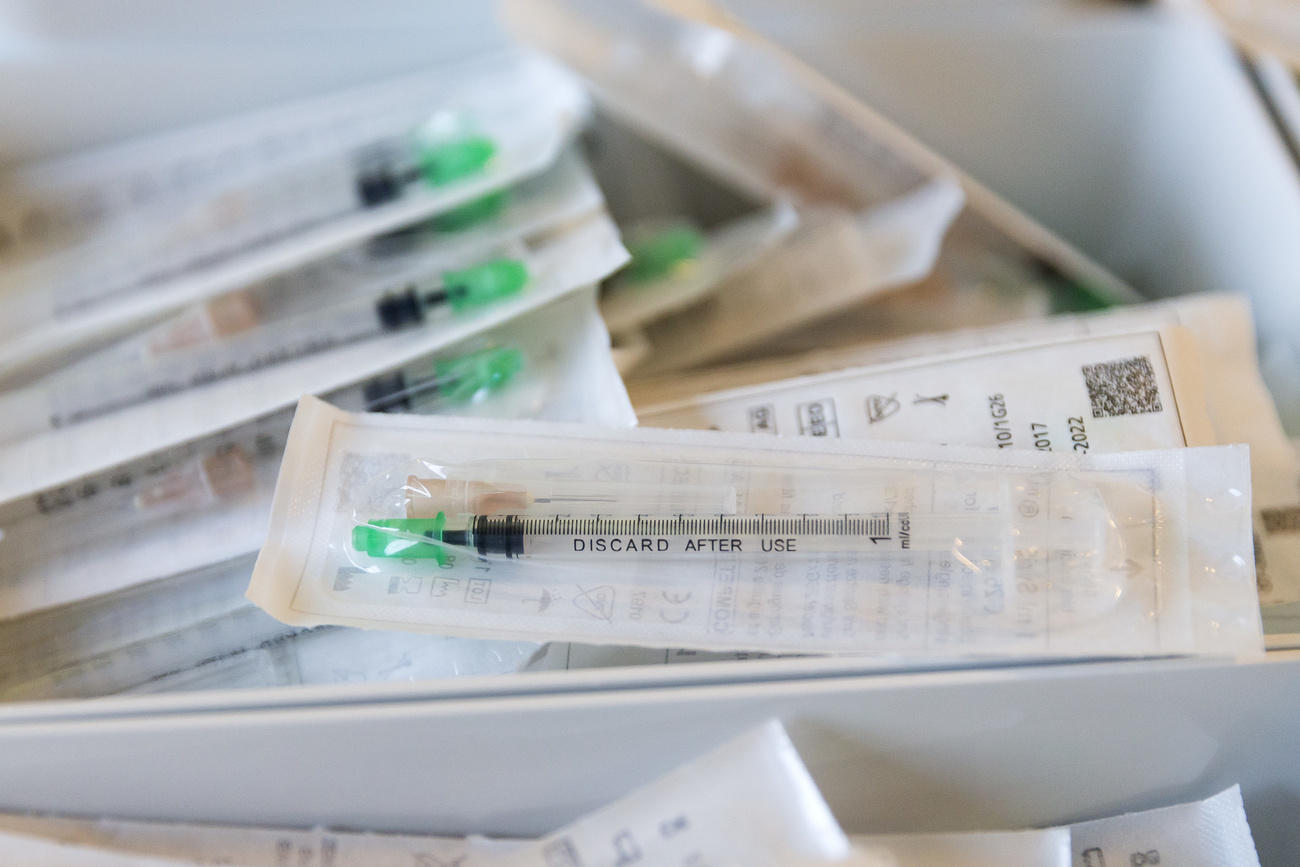
Menschen, die am Rand der Gesellschaft leben, sind von der Covid-19-Pandemie besonders betroffen. In der Schweiz sind Drogenabhängige angesichts der Ausnahmesituation noch stärker isoliert als sonst; und die zunehmende Knappheit illegaler Drogen gefährdet ihre Gesundheit zusätzlich. Ärzte und Organisationen machen mobil.
Die Pandemie und die Massnahmen zur Bekämpfung der Ausbreitung des Coronavirus treffen gewisse Menschen in der Schweiz, die sonst schon zu den Verletzlichsten gehören, besonders hart. Dies gilt etwa für Drogenabhängige, deren tägliches Leben über Nacht auf den Kopf gestellt wurde, und die sich nun zusätzlich zu ihrer Sucht und ihrer oft schon bestehenden sozialen Isolation an die neue Situation anpassen müssen.

Mehr
Sexarbeiterinnen ohne Lohn: Abtauchen ins Elend
«Diese Bevölkerungsgruppe ist von der aktuellen Situation viel stärker betroffen», sagt Rahel Gall, Direktorin der Stiftung ContactExterner Link, die im Kanton Bern zahlreiche Dienstleistungen für Suchtkranke anbietet.
«Es handelt sich oft um Menschen mit gesundheitlichen Problemen. Sie gehören zu den Risikogruppen und fühlen sich sehr einsam, weil sie kein stabiles soziales Netz um sich herum haben.»
Trotz der Pandemie ist es der Organisation gelungen, ihre Strukturen so anzupassen, dass sie ihre Dienstleistungen weiter anbieten kann. Auch wenn vor allem Sozialhilfe und medizinische Versorgung reduziert werden mussten.
Um die Vorgaben des Abstandhaltens einhalten zu können, musste Contact zum Beispiel die Anzahl der Personen begrenzen, die sich gleichzeitig in den Drogenanlaufstellen aufhalten können. Dies lief in Biel recht gut, da dort nur einige wenige zusätzliche Plätze organisiert werden mussten.
Kritischer war die Situation in Bern, wo die Zahl der Plätze in der Anlaufstelle halbiert werden musste. Statt 22 können zur Zeit nur 11 Personen aufs Mal im Raum sein, um ihren Stoff zu konsumieren. Alle anderen müssen warten.
«Wenn ein Süchtiger seinen Stoff braucht, kann er nicht lange warten», sagt Gall. «Es besteht die Gefahr, dass wieder vermehrt auf der Strasse konsumiert wird.»
Rückkehr der offenen Szenen vermeiden
«Es besteht die Gefahr, dass wieder vermehrt auf der Strasse konsumiert wird.»
Rahel Gall, Contact
Und tatsächlich haben seit Beginn der Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus einige Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bern festgestellt, dass das Spritzen von Drogen an öffentlichen Plätzen zugenommen hat.
«Eines unserer Hauptziele ist, die Rückkehr einer offenen Drogenszene zu verhindern, wie wir sie in den 1990er-Jahren erlebt hatten», sagt Gall. «Daher haben wir hart daran gearbeitet, die Zahl der überwachten Konsumräume zu erhöhen.»
Zusammen mit der Stadt Bern hat Contact nun eine Lösung gefunden, um Zelte und Container aufstellen zu können. Ab dieser Woche sind wieder alle 22 Plätze verfügbar.
«So können wir den Konsum von Substanzen im öffentlichen Raum einschränken. Aber weil wir andere Dienstleistungen reduziert haben und der Zutritt zu den Räumlichkeiten beschränkt ist, werden viele der abhängigen Menschen weiterhin Zeit auf der Strasse verbringen», sagt die Direktorin der Stiftung.
Bisher hat Contact weder unter ihren Mitarbeitenden noch unter den Leuten, welche die Angebote der Organisation nutzen, Kenntnis von Personen, die an Covid-19 erkrankt sind.

Der Alltag der Drogenkranken ist mit dem Coronavirus auch in anderen Bereichen noch härter geworden: Passantinnen und Passanten wollen sich denen, die um ein paar Münzen betteln, gar nicht erst nähern, und illegale Drogen gehen wegen der Schliessung der Grenzen langsam zur Neige.
«Wir starten diese Woche ein Projekt, um neue Leute für unser Substitutionsprogramm zu gewinnen», sagt Gall. «Dies könnte jenen helfen, die auf dem Schwarzmarkt keine Produkte mehr finden oder Angst haben, tiefer in den Drogenhandel einzutauchen.»
Sollte die Situation jedoch anhalten, warnt die Direktorin, könnte der Mangel an illegalen Substanzen noch ausgeprägter werden, und die Einsamkeit der Drogenkranken könnte sich weiter verschlimmern. Das nächste Ziel der Stiftung sei nun, nach Menschen zu suchen, die seit Beginn der Pandemie abgetaucht seien, um abzuklären, wie es ihnen gehe und um ihnen zu helfen, nicht zu sehr zu verzweifeln.
«Wir denken darüber nach, direkt in den Konsumräumen präsent zu sein.» Daniele Zullino, HUG
Gefahren, wenn illegale Drogen knapp werden
Auch die Strukturen, die pharmazeutisches Heroin auf ärztliche Verschreibung abgeben, mussten sich an den Kontext der Pandemie anpassen. Beim Dienst für SuchtmedizinExterner Link der Universitätsspitäler in Genf (HUG) kommen Personen, die früher zweimal täglich ihr Produkt abholten, jetzt alle zwei Tage vorbei. Einige erhielten ausnahmsweise genug, um sieben Tage durchzukommen, indem ihre Behandlung mit anderen, allgemein gut verträglichen Substanzen kombiniert wurde.
«Diese Situation scheint unseren Patienten zu passen, sie machen mit und haben bisher sehr verantwortungsbewusst gehandelt, keiner von ihnen wurde angesteckt», sagt Daniele Zullino, Chefarzt des Diensts für Suchtmedizin. «Aber sie sind oft beunruhigt, weil ihr Durchschnittsalter 50 Jahre beträgt und sie zu den Risikogruppen gehören.»

Mehr
«Bleiben Sie zu Hause.» Und wer kein Zuhause hat?
Rund siebzig Drogenkranke nehmen am Programm zur ärztlichen Heroinverschreibung der Genfer Universitätsspitäler teil, die bisher ohne Probleme die benötigten Medikamente von ihrem Lieferanten erhalten haben.
Ganz anders sieht die Situation auf dem Schwarzmarkt aus: Wie in Bern herrscht auch in Genf zunehmender Mangel an Heroin, und der noch verfügbare Stoff ist von schlechter Qualität.
Der Dienst für Suchtmedizin hat daher seine Zusammenarbeit mit der Genfer InjektionsstelleExterner Link intensiviert: «Um zu verhindern, dass Abhängige gefährliche Substanzen oder Fentanyl einnehmen, was in den USA und Kanada verheerende Folgen hatte, haben wir die Schwelle für den Zugang zu unseren Verschreibungen von Heroin und Opioiden gesenkt», sagt Zullino.
«Das bedeutet, dass wir die Bürokratie abgebaut haben und Einzelpersonen sehr schnell integriert werden können». Im Verlauf einer Woche konnten bereits ein Dutzend weitere Patientinnen und Patienten in diese Programme aufgenommen werden.
Zullino ist jedoch besorgt, was die Zukunft bringen wird: Wenn die Krise anhält, könnten einige Menschen auf gefährlichere Produkte zurückgreifen, die sich dann in der Schweiz ausbreiten könnten. «Wir denken darüber nach, direkt in den Konsumräumen präsent zu sein, damit wir diese Menschen in unsere Programme aufnehmen und ihnen den verschriebenen Stoff direkt vor Ort geben könnten, damit sie auch nicht noch woanders hingehen müssten.»
(Übertragung aus dem Französischen: Rita Emch)

In Übereinstimmung mit den JTI-Standards














Einen Überblick über die laufenden Debatten mit unseren Journalisten finden Sie hier. Machen Sie mit!
Wenn Sie eine Debatte über ein in diesem Artikel angesprochenes Thema beginnen oder sachliche Fehler melden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an german@swissinfo.ch