«Italien hat mir mein Studium bezahlt, doch nun profitiert die Schweiz»

Alessandro Fammartino, 39-jährig aus Turin, erzählt von seiner Erfahrung als italienischer Einwanderer in Zürich, wo er nun schon seit neun Jahren mit seiner Schweizer Partnerin lebt und in der Biotechnologie-Branche arbeitet. Eine Wahl, die er nicht bereut, obwohl ihm seine Familie fehlt.
«Ich bin in Turin geboren und aufgewachsen und habe dort auch mein Studium absolviert. Nach dem Gymnasium mit Schwerpunkt in Naturwissenschaften habe ich Biotechnologie studiert und erfolgreich abgeschlossen.»
Die berufliche Karriere von Alessandro Fammartino beginnt im Piemont in Norditalien. Seine Geschichte liest sich wie viele Geschichten von Italienern mit einem Hochschulabschluss im naturwissenschaftlichen Bereich, die sich entschieden haben, im Ausland zu arbeiten. Zum Teil aus Neugier und persönlichem Ehrgeiz, aber auch ein wenig aus Enttäuschung über das italienische universitäre System.
«Für mich gab es verschiedene Faktoren, die mich dazu bewogen wegzugehen, sicher waren aber die knappen Mittel für die Forschung und die geringen Aufstiegsmöglichkeiten innerhalb des italienischen Systems ein wichtiger Grund dafür», erzählt er. Zuerst arbeitete er während sechs Monaten in Grossbritannien als Forschungsassistent, dann in Deutschland, Frankreich und landete schliesslich in der Schweiz, wo er seither arbeitet.
«Ich bin vor zehn Jahren nach Zürich gekommen, fast zufällig, durch einen meiner Kontakte», erzählt Alessandro. «Heute mit 39 Jahren habe ich eine Schweizer Partnerin, einen Job, der mich glücklich macht und zwei Töchter, die hier geboren sind und bereits drei Sprachen sprechen.»
«Die Schweiz ist wie ein Europa in Kleinformat: Es leben vier Kulturen in einem föderalen System friedlich miteinander.»
«Über den Tellerrand hinausschauen»
Alessandro ist der Erste aus seiner Familie, der Italien verlassen hat. «Man könnte sagen, dass ich ein wenig der Wegbereiter bin: Ich wollte immer reisen und neue Kulturen kennenlernen und meinen Horizont erweitern. In meiner Familie gibt es diese Tradition nicht, und bevor ich hierherkam, hatte ich keine Kontakte mit andern Italienern in der Schweiz. Heute bin ich der Erste, der dazu rät, sich gegenüber der Welt zu öffnen und über den Tellerrand hinauszuschauen.»
Nach einem Postdoc in Biotechnologie war für Alessandro der Moment gekommen, sein Wissen nun in der Industrie anzuwenden. «Ich arbeite in einer angesehenen internationalen Firma und beschäftige mich seit sechs Jahren mit der DNA-Sequenzierung», erzählt Alessandro.
«Unter anderem analysieren mein Team und ich die DNA von Tumorpatienten mit dem Ziel, die für die einzelne Person geeignetste Behandlung zu bestimmen. Durch die Genanalyse des Patienten können wir genauere Diagnosen stellen und weniger invasive Behandlungen anbieten.»
Ein Beruf, der einen direkten Einfluss auf das Leben von Menschen hat – die Schweizer Bürger eingeschlossen –, die sich oft unwissend den Technologien anvertrauen, die die Firma entwickelt.
Italienischer Staat investiert, Schweiz profitiert
«Mein Studium in Italien war die Grundlage für alles Weitere, und ich habe festgestellt, dass die Qualität der italienischen Schulen und Universitäten sehr hoch ist», betont Alessandro. «Es ist nicht zufällig, dass die italienischen Forscher im Ausland einen sehr guten Ruf haben.»
Doch wie viele italienische Wissenschaftler, die ihr Land verlassen haben, hinterfragt auch Alessandro die Ungereimtheiten des italienischen akademischen Systems. «Der italienische Staat hat viel investiert, er bezahlte mir mein Studium und mein Doktorat, doch nun ist es eine Schweizer Firma, welche die Früchte erntet.»
Im schweizerischen akademischen System sei die Wertschätzung höher als in Italien. «In Italien sind die Forscher gezwungen, unter der Kontrolle von anerkannten Professoren zu arbeiten, und es reicht nicht, wissenschaftliche Arbeiten publiziert zu haben, um den eigenen Wert aufzuzeigen. In der Schweiz passiert dies nicht, weil der Wettbewerb viel offener ist: Wenn ich wissenschaftliche Publikationen vorweisen kann, könnte auch ich Professor werden, während dies in Italien nicht genügen würde. Ich bräuchte eine Empfehlung eines hochrangigen Professors.»
Die Familie fehlt
Alessandro vermisst viele Sachen aus der Heimat, wie die Mehrheit der südeuropäischen Einwanderer, die in der Schweiz leben. «Mir fehlen meine Freunde in Italien und auch die Unterstützung meiner Familie», erzählt Alessandro, wenn er daran denkt, was er alles in Turin zurückgelassen hat.
Als Spezialist für Datenjournalismus schreibt Jacopo OttavianiExterner Link für internationale Zeitungen wie The Guardian, Al Jazeera International, El Pais und in Italien für die ausführliche Wochenzeitung Internazionale. Im Jahr 2015 erhielt er verschiedene Preise für das Projekt E-waste RepublicExterner Link, eine Reportage über den Elektroschrottmarkt in Ghana und anderen Gegenden der Welt. 2014 beteiligte er sich am Projekt The migrants filesExterner Link, einem internationalen Datenjournalismus-Projekt über die Migration in Europa. Im gleichen Jahr koordinierte er Generation E, das erste Crowdsourcing-Projekt zur europäischen Jugend-Abwanderung. Dieser Artikel wurde realisiert dank gesammelten Daten über die Generation E.
«Die Hilfe der Grosseltern wäre schön gewesen, sowohl für uns wie auch für sie. Zum Glück sind wir nicht so weit von Turin entfernt und können hin und wieder runterfahren. Jedes Mal, wenn wir heimkehren, nehmen wir die Zutaten mit, die wir brauchen, um unsere italienischen Lieblingsgerichte zubereiten zu können.»
Wie viele Ausländer, die in Zürich leben, verkehrt auch Alessandro vor allem mit anderen Expats. «In meinem Forschungs- und Arbeitsumfeld herrscht ein ständiges Kommen und Gehen von Forschern und Arbeitnehmern aus aller Welt, und es ist schwierig, sich mit jemandem ausserhalb dieser Blase anzufreunden.» Auch die Sprache hilft da nicht: Trotz fast zehn Jahren in Zürich spricht Alessandro noch nicht fliessend deutsch.
Die Schweiz, ein Europa in Kleinformat
Zum Thema Europa und Pass meint Allessandro, dass er sich mit der italienischen Staatsbürgerschaft bestens fühlt. «Ich könnte einen Antrag stellen oder meine Lebensgefährtin heiraten, die aus der französischen Schweiz kommt, doch ehrlich gesagt habe ich nie daran gedacht, die Schweizer Staatsbürgerschaft zu beantragen, weil es mir gefällt, mich als Italiener zu fühlen. Zudem habe ich noch nie etwas Diskriminierendes erlebt.»
Nach Ansicht von Alessandro ist die Schweiz, obwohl sie technisch gesehen nicht Mitglied der EU ist, gut integriert und bietet dem Rest des Kontinents einen positiven Input. «Die Schweiz ist wie ein Europa in Kleinformat: Es leben vier Kulturen in einem föderalen System friedlich miteinander», reflektiert Alessandro, «genau ein solches Modell hätte Europa nötig.»
Haben auch Sie sich dazu entschlossen, in die Schweiz auszuwandern? Erzählen Sie uns Ihre Geschichte per Kommentar!
(Übertragen aus dem Italienischen: Christine Fuhrer)

In Übereinstimmung mit den JTI-Standards



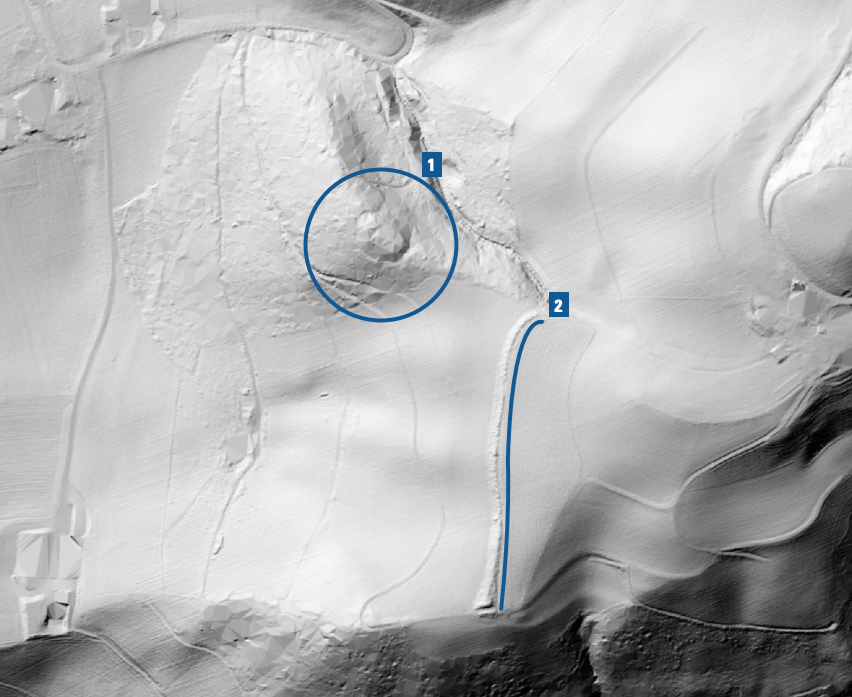








Einen Überblick über die laufenden Debatten mit unseren Journalisten finden Sie hier. Machen Sie mit!
Wenn Sie eine Debatte über ein in diesem Artikel angesprochenes Thema beginnen oder sachliche Fehler melden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an german@swissinfo.ch