«Alle Schweizer sollten einmal im Leben auswandern»

Die Schweiz muss sich für ihre Auswanderer interessieren, denn sie verfügen über ein riesiges Know-how und lokales Wissen, das die Schweizer Politik und die Wirtschaft nutzen könnten. Das sagt Professor Walter Leimgruber, Präsident der Migrationskommission, im Interview mit der Neuen Zürcher Zeitung.
NZZ: Herr Leimgruber, jedes Jahr wandern netto mehr Schweizerinnen und Schweizer aus. Warum?
Walter Leimgruber: Früher wanderte man aus, weil man musste. Man war arm, die einzige Möglichkeit, sich ein Leben aufzubauen, war die Auswanderung. Das ist global gesehen noch heute der Hauptgrund für Migration. Aber es gab immer auch Menschen, die gingen, weil sie sich verliebt oder weil sie eine Herausforderung gesucht haben. Diese Menschen verstehen das Leben als Projekt. Und sie stellen fest: In der Schweiz kann man zwar viel machen, aber es gibt eine klare Grenze.
Viele Auswanderer sind zwischen 20 und 35 Jahre alt und sehr gut ausgebildet. Sie sagen sich: Ich will eine Herausforderung, für die ich alles einsetzen muss, was ich habe. In der Schweiz kommen sie damit zwar auf die nächste Hierarchiestufe, aber etwas wirklich Tolles, Neues, Revolutionäres können sie nicht erreichen. Deshalb suchen sie sich Länder aus, die so etwas ermöglichen. Das sind die klassischen Auswandererländer wie die USA, Australien, Neuseeland – aber sie gehen auch in aufsteigende Länder wie China.
NZZ: Haben sie das Gefühl, dort sei mehr los als hier?
W.L.: Genau. Sie wollen Teil einer neuen Dynamik sein. Diese Dynamik fehlt ihnen in der Schweiz.
NZZ: Ein Auswanderer flieht heute also auch vor einer gewissen Wohlstandsapathie?
W.L.: Ja. Die Leute, die etwas Spezielles leisten wollen, finden in der Schweiz keine Gestaltungsmöglichkeiten. Sie erzählen immer dieselbe Geschichte: Wenn du in der Schweiz etwas umsetzen willst und du scheiterst, bekommst du immer den Satz zu hören: «Ätsch, ich habe dir ja gesagt, dass das nicht funktioniert.»
Walter Leimgruber ist Vorsteher des Seminars für Kulturwissenschaft und Europäische Ethnologie an der Universität Basel und Präsident der Eidgenössischen Migrationskommission.
NZZ: Hat die Schweiz ein Problem?
W.L.: Die Schweiz hat ein Problem, die mutigen, kreativen, schöpferischen Menschen zu halten. Die Auswanderer, mit denen wir im Rahmen eines Nationalfondsprojekts gesprochen haben, sind Menschen mit einem gesunden Selbstbewusstsein, mit Risikofreude, Neugier und Offenheit – genau jenen Fähigkeiten also, die man in der Gesellschaft und der Wirtschaft brauchte. Sie sind der Schweiz dankbar für ihre gute, relativ günstige Ausbildung, aber sie stossen hier an eine gläserne Decke. Sie sagen: Das ist nicht die Gesellschaft, in der wir leben wollen.
NZZ: Suchen Auswanderer die Möglichkeit zu scheitern?
W.L.: Fast alle von ihnen sind schon einmal gescheitert. Die Ausgewanderten kämpfen oft hart und arbeiten in der Regel mehr als in der Schweiz, für weniger Geld und soziale Sicherheit. Sie scheitern mit ihren Ideen oft ein-, zweimal, erfahren aber auch viel Ermutigung vom Umfeld. Und stehen wieder auf.
NZZ: Muss man nicht der Gerechtigkeit halber sagen, Schweizerinnen und Schweizer können es sich auch leisten, auszuwandern – weil sie immer die Möglichkeit haben, ins reichste Land der Welt zurückzukehren und von einem stabilen sozialen Sicherheitsnetz aufgefangen zu werden?
W.L.: Natürlich handelt es sich hier um eine privilegierte Migration. Es gibt viele, die zurückkommen. Migration hat sich ja auch verändert. Man versucht es einfach einmal. Es gibt die sogenannte Kaskadenmigration, man probiert es im einen Land und geht dann in ein nächstes. Und es gibt auch immer mehr Pendelmigration, das sind Menschen, die zwei Jobs in zwei Ländern haben. Der Verrückteste, den ich kennengelernt habe, war ein Skilehrer, der im Winter hier und im Sommer in Neuseeland seinen Job ausgeübt hat.

NZZ: Was sind die Gründe, in die Schweiz zurückzukommen?
W.L.: Es gibt zwei wesentliche Gründe. Einerseits sind es die hohen Ausbildungskosten für die Kinder im Ausland. Gerade eine höhere Ausbildung ist oft extrem teuer. Und andererseits ist die Schweiz angenehm, wenn man alt wird: Es ist ruhig, der Service ist gut und die medizinische Versorgung hervorragend.
NZZ: Kann man sagen, das Leitmotiv der Auswanderer sei ein grosser Drang nach Individualismus?
W.L.: Es geht um Selbstverwirklichung. Man will aus seinem Leben möglichst viel herausholen. Das ist durchaus auch egoistisch, aber es ist ein Egoismus, der für viele andere fruchtbar ist. Die leisten ja durchaus etwas, auch im ökonomischen Sinne.
NZZ: Es handelt sich bei vielen Auswanderern um moderne Nomaden, die von Ort zu Ort, von Land zu Land ziehen, ihre politische und ideelle Verankerung ist oft gering. Hat die nationalstaatlich organisierte Welt mit ihnen einen Umgang gefunden?
W.L.: Neu ist, dass die Auswanderung über viel grössere Strecken und viel häufiger passiert. Schaut man aber historisch, waren schon immer viele Menschen ständig unterwegs: die Handwerker, die Händler, die Banker, die Söldner, die Armen. Unsere nationalstaatliche Geschichtsschreibung aber ist vom Gedanken geprägt, Sesshaftigkeit sei der Normalfall und Migration ein Problem. Die Realität war immer eine andere. Und Staat und Gesellschaft tun sich noch immer schwer mit dieser Realität.
NZZ: Heute muss jedes kleine und mittelgrosse Unternehmen (KMU) global aufgestellt sein.
W.L.: Genau. Bloss ist die Gesellschaft dazu nicht bereit; die politischen Entwicklungen zeigen dies. Es ist aber heute so, dass immer weniger Menschen sagen können: Ich bin Schweizer und wohne in der Schweiz. Immer mehr Menschen haben zwei oder gar drei Pässe. Die Formen der Zugehörigkeit ändern sich. Das macht den national verfassten Gesellschaften und Regierungen offenbar Angst. Deshalb bestimmen die Sesshaften heute das politische Geschehen, weil sie Angst haben, von den Mobilen überrollt zu werden. Man sieht das in der Schweiz gut. Firmen haben hier extreme Mühe, Schweizer zu finden, die für sie in die Welt hinausgehen. Also holen sie Mitarbeiter aus dem Ausland, die das tun, was wiederum dazu führt, dass die Zurückbleibenden Angst um ihren Job haben.
NZZ: Gibt es eine Lösung?
W.L.: Es braucht vielleicht ein Selbstverständnis, dass alle einmal in ihrem Leben auswandern sollten, gerade in jungen Jahren; es muss ja nicht für immer sein. So eignet man sich neue Kompetenzen in anderen Sprachen und Kulturen an. Leider ist es immer noch eine Minderheit, die dies tut. Gerade für ein reiches Land wie die Schweiz wäre es aber eine Möglichkeit, sich für die Zukunft zu rüsten.
NZZ: Was Sie hier ausführen, sind Erkenntnisse aufgrund einer beschränkten Datenbasis. Ihre Studierenden und Sie selber haben mit vielen Auswanderern gesprochen. Aber es gibt keine repräsentative Studie über die Motive der Ausgewanderten. Warum?
W.L.: Die Schweiz hat sich nie für ihre Auswanderer interessiert – auch statistisch nicht. Das hat mit dem Glauben zu tun, ein guter Staatsbürger sei sesshaft. Und wir sind das reichste Land der Welt, aus dem wandert man ja wohl nicht aus. Für einige ist ein Auswanderer ein Landesverräter. Stattdessen führen wir seit dem späten 19. Jahrhundert einen Einwanderungsdiskurs. Die Auswanderung wird negiert, auch politisch.
NZZ: Warum muss sich die Politik für Auswanderung interessieren?
W.L.: Weil es dabei um sehr viele Menschen geht. Man schätzt, dass 700’000 Schweizerinnen und Schweizer im Ausland leben. Genau weiss man es nicht, weil man es nicht genau wissen will. Die Auswanderer, mit denen ich gesprochen habe, sagen: Für uns interessiert sich die offizielle Schweiz nicht. Vielleicht zündet die Botschaft am 1. August einmal ein Feuer an und verteilt ein paar Cervelats. Nötig wäre aber, sich mit diesen Menschen zu vernetzen. Die haben ein riesiges Know-how, lokales Wissen vor allem, das die Schweizer Politik und die Wirtschaft nutzen könnten. Aber eben: Die hiesige Politik hört lieber auf Älpler, die Angst haben vor der Welt, die sie nie gesehen haben.

In Übereinstimmung mit den JTI-Standards









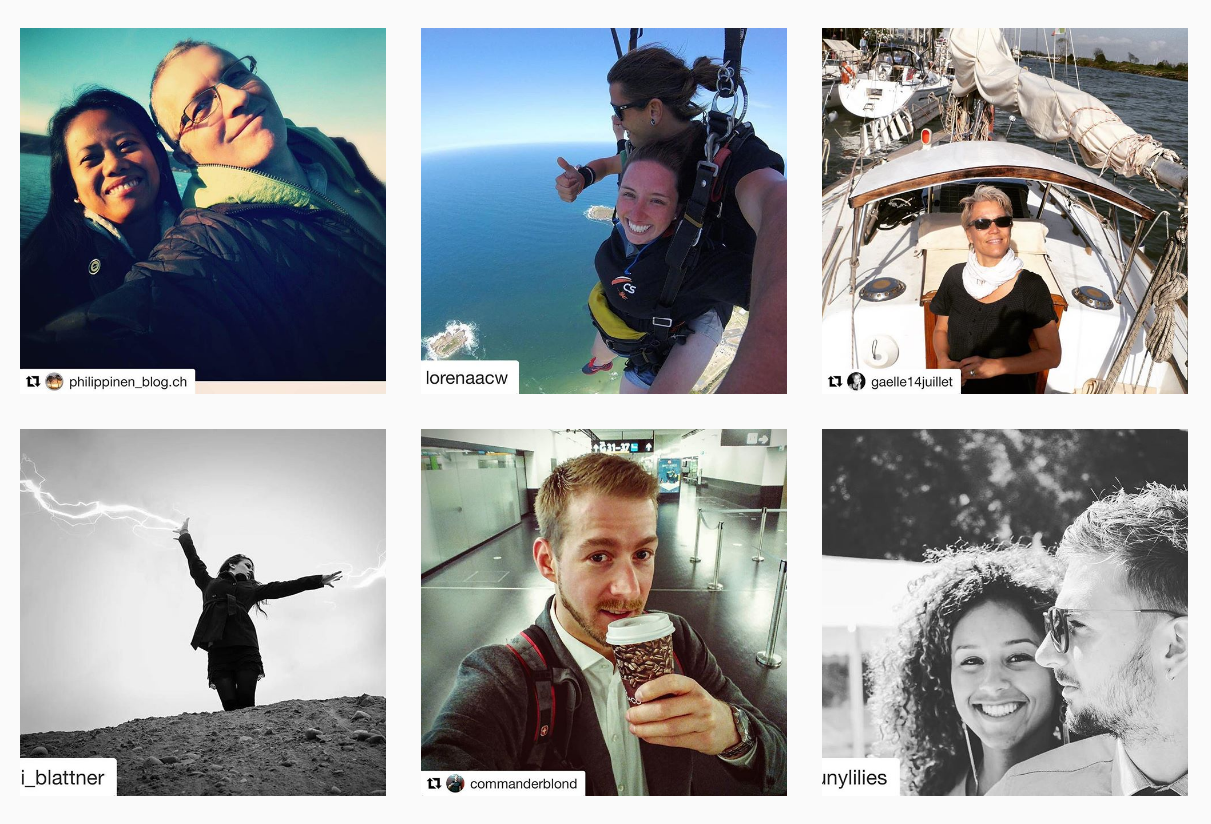

Einen Überblick über die laufenden Debatten mit unseren Journalisten finden Sie hier. Machen Sie mit!
Wenn Sie eine Debatte über ein in diesem Artikel angesprochenes Thema beginnen oder sachliche Fehler melden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an german@swissinfo.ch