Die Entfesselung der Bedürfnisse

1968 kam nicht Knall auf Fall. Die Serie "Vor `68" wirft Schlaglichter auf die Veränderungen in der Schweiz nach 1945. Ende der 60er-Jahre entdeckte die Wirtschaft die Jugend und die Frauen als Konsumenten. Von Anfang an war die Begierde eine Ingredienz der Revolte.
1967 zerlegten Jugendliche das Hallenstadion an einem Rolling Stones Konzert, ein Jahr später vor dem Globuskrawall, waren Flugblätter im Umlauf, die «I can’t get no satisfaction» zum revolutionären Slogan erhoben – gegen «Feierabend, Fernseher, Filzpantoffel, Flaschenbier». Die Hymne der Stones passte zu Strassenkampf genauso wie zu Gesprächen über Orgasmusschwierigkeiten – aber eben auch zu Shopping-Nachmittagen in der Innenstadt.
Eine der liebgewonnenen Erzählungen über «1968» ist, dass der Kampf gegen die Lustlosigkeit der Gesellschaft einzig eine Forderung der protestierenden, jugendlichen Seite war. Doch das ist nicht ganz so – die «Psychodynamik der Sehnsucht», wie sie der Historiker Jakob Tanner einmal nannte, trieb die ganze Gesellschaft an.
Selbstentdeckung im Warenhaus
Im Frühling 1959 rief eine Inserate-Kampagne die Menschen Zürichs in vertrautem Du dazu auf, sich selbst besser kennen zu lernen: «Entdecke Dich selbst! In jedem Menschen schlummert viel mehr, als er selber weiss.» Die Angesprochenen wurden mit Marco Polo, Magellan und Kolumbus verglichen, nur dass sie in ihr eigenes Inneres segeln sollen. Doch nicht ein obskures Lebensreform-Institut oder eine Künstlergruppe wollte die Zürcher und Zürcherinnen auf Entdeckungsreise durchs eigene Ich jagen, sondern das Warenhaus Globus. Durch die Regale schweifend sollten die Kunden und Kundinnen ihre brachliegenden inneren Kräfte «zum Blühen bringen» – indem sie zum Beispiel neues Grillzubehör kauften. Einige Jahre später sollte der Chef-Innenausstatter des Kaufhauses, Peter Kaufmann, darüber philosophieren, das Einkaufen vermöge den Menschen des blossen «Dahin-Lebens» zu entreissen. Das Warenhaus wurde in den 1960ern ein Ort der Bewusstseinserweiterung.

Mehr wollen, wünschen, weniger sparen
Ende der 1940er Jahre hatte die Migros die Selbstbedienung in der Schweiz eingeführt, Kunden und Kundinnen liefen nun als Leute, die es zum Kauf zu inspirieren galt, durch die Regale. Zur selben Zeit eröffnete die US-amerikanische Marktberatungsfirma Ernest Dichter ihre erste Filiale in der Schweiz. Ihr Besitzer, Ernest Dichter, gerierte sich anfangs der 1960er Jahre zunehmend als Herbert Marcuse des Konsums. Seiner Ansicht nach hatte der Westen gegen den damals als überlegen erachteten, sozialistischen Osten, nur eine Chance: Die Entfesselung der Bedürfnisse, das Abwerfen aller puritanischen Fesseln. Denn, so meinte er 1961 in seinem programmatischen Buch «Strategy of Desire», die freie Marktwirtschaft könne «nicht bestehen, wenn wir nicht endlich aufhören, ein bequemes Leben als unmoralisch anzusehen.» Im selben Jahr forderte der Werbetheoretiker Pierre Martineau an einem Kongress des Migros-Think-Tanks «Im Grüene» – heute als GDI bekannt – eine «Umerziehung» der Bevölkerung: Man müsse die Leute dazu erziehen, mehr zu wollen, mehr zu wünschen, die Sparsamkeit der Kriegsjahre hinter sich zu lassen. Diese Neuausrichtung der Marktforschung auf die Eroberung neuer Bedürfnisse hing auch damit zusammen, dass der als derart konform wahrgenommene Massenkonsum langsam eine Sättigungsgrenze erreicht hatte: Die Dinge, die «man» brauchte, waren verkauft, fast alle hatten nun Kühlschränke, Küchenmaschinen und Fernseher. Nicht zuletzt deswegen kamen vermehrt zielgruppenorientierte Produkte auf – der Konsum wurde differenziert. Waren wurden stärker als Bausteine für die eigene Identität angeboten – und nicht zuletzt wurde die Jugend als Konsumentinnengruppe entdeckt.
Die Barbie-Puppen-Debatte
Das Programm hiess: Mehr Ich, mehr Wünsche, mehr Lüste – mehr satisfaction. Aber natürlich war diese Neuausrichtung der Gesellschaft umstritten. Das zeigte sich zum Beispiel im Kulturkampf um das «Puppenproblem Nummer Eins»: Barbie kam in der Schweiz ab 1965 in die Spielzeugläden – nicht zur Freude aller. In der Frauenzeitschrift Annabelle wurde sie als «Sexbömbchen» geschildert, die keinerlei «moralischen Ballast» mehr mit sich herumtrage, im Schweizer Fernsehen trauerte man um die alten Puppen, die man noch zum «Wickeln und Liebhaben» wollte. Barbie wurde im Bericht der «Annabelle» als promiske Puppe geschildert, die dem Geist des Konsums und der Werbung entsprungen war und gerade dadurch zum begehrten Role-Model junger Mädchen wurde.

Die ideale Konsumentin war nicht mehr die vernünftig rechnende Hausfrau und Mutter, sondern eine auf ihre eigenen Begehren und Selbstdarstellung fokussierte junge Frau. Die Aufregung konnte durchaus als Erfolg des marktspychologischen Produktedesign, das hinter der Puppe steckte, gesehen werden: Der Produktion von Barbie war eine marktpsychologische Studie des Ernest Dichter Institutes vorangegangen: Dort war eine Doppelverkaufsstrategie für «Barbie» vorgesehen: Einerseits sehe die kaufende Mutter in Barbie eine Puppe, mit der ihre Tochter lernen könne, mit Kleidung und Stil umzugehen, um eine attraktive Heiratskandidatin zu werden. Zugleich aber, meinte Dichter, sei die Puppe für die Tochter ein «Mittel der Rebellion» gegen ihre Eltern. Konsum und Revolte liessen sich Mitte der 1960er Jahre nicht mehr trennen.

In Übereinstimmung mit den JTI-Standards

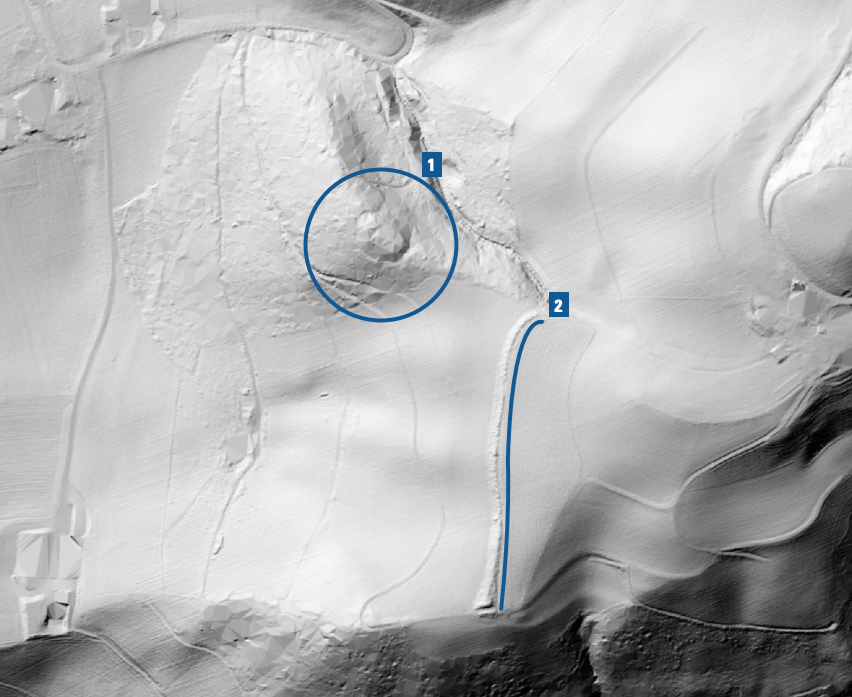









Einen Überblick über die laufenden Debatten mit unseren Journalisten finden Sie hier. Machen Sie mit!
Wenn Sie eine Debatte über ein in diesem Artikel angesprochenes Thema beginnen oder sachliche Fehler melden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an german@swissinfo.ch