Das Schweizer Gesundheitswesen kurz erklärt

Die Gesundheitskosten steigen in der Schweiz derart rasant, dass sich alle einig sind: So kann es nicht weitergehen. In einer Serie beleuchten wir die drängendsten Probleme. Zu Beginn ein kleiner Überblick, wie das Schweizer Gesundheitswesen funktioniert.
Das Schweizer Gesundheitswesen ist eine Mischung aus Staat und Privatwirtschaft: Private Krankenversicherungen agieren auf einem stark reglementierten Markt, Leistungserbringer wie Ärzte und Spitäler sind teils privat, teils staatlich.
Dazu kommt: Die Gesundheitsversorgung ist eigentlich Sache der Kantone, doch bestimmte Dinge sind gesetzlich auf nationaler Ebene geregelt. Deshalb ist das Schweizer Gesundheitswesen ziemlich zersplittert und unübersichtlich organisiert. Dies ist mit ein Grund, weshalb es zu den teuersten der Welt gehört.

Mehr
Schweizer Gesundheitswesen zwischen Staat und freiem Markt
Vergleichende Studien haben ergebenExterner Link, dass dafür Qualität und Versorgung gut sind: Die Schweiz hat ein dichtes Netz von Ärzten und Spitälern. Im Unterschied zu staatlichen Gesundheitsdiensten wie beispielsweise in Grossbritannien (siehe Box) müssen Patienten in der Schweiz nicht monatelang auf einen Termin warten.
Patienten zahlen kräftig mit
In der Schweiz ist jeder Bürger obligatorisch grundversichert und zahlt monatlich Prämien an eine Krankenkasse seiner Wahl. Zwischen den Kassen besteht somit ein Wettbewerb; die Prämien sind je nach Kasse und Kanton unterschiedlich hoch. Wer in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen lebt, bekommt vom Wohnortskanton eine PrämienverbilligungExterner Link. Die Kassen müssen jeden Patienten grundversichern, auch wenn er bereits krank oder alt ist. Nur bei den privaten Zusatzversicherungen besteht Vertragsfreiheit.
Patienten müssen sich bis 300 Franken jährlich mit an den Kosten beteiligen. Sie können auch eine höhere Franchise wählen – bis zu 2500 Franken – und zahlen dann weniger Prämien. Das bedeutet konkret: Wenn ein Patient die höchste Franchise von 2500 Franken wählt, muss er seine Arztrechnungen und Medikamente bis zu diesem Betrag selbst bezahlen. Erst danach zahlt die Kasse.
Das ist aber noch nicht alles: Auch nach Überschreitung der Franchise bezahlt der Patient bei jeder Leistung einen Selbstbehalt von 10% – bei manchen Medikamenten sogar 20% – bis zum maximalen Betrag von 700 Franken. Bei einem Spitalaufenthalt zahlt der Patient zudem einen täglichen Beitrag von 15 Franken.

Spitalfinanzierung: Viele Akteure
Trotzdem reicht das Geld nicht, der Staat muss bei den Spitälern mitfinanzierenExterner Link: Im stationären Bereich tragen die Kantone 55 Prozent der Kosten, die Krankenkassen übernehmen 45 Prozent. Im ambulanten Bereich hingegen bezahlen die Kassen 100 Prozent. Das führt dazu, dass die Kantone die Spitalaufenthalte möglichst kurzhalten wollen. Der Trend «ambulant vor stationärExterner Link» ist umstritten, man spricht von «blutigen Entlassungen», wenn ein Patient zu früh nach Hause geschickt wird.
Die Kantone führen Spitallisten: Diese Spitäler können über die Grundversicherung abrechnen und erhalten öffentliche Beiträge, im Gegenzug müssen sie die medizinische Versorgung der Bevölkerung sicherstellen (LeistungsauftragExterner Link). Die Kantone setzen dabei auch Behandlungsschwerpunkte und Spezialisierungen, damit nicht alle Spitäler die ganze Palette medizinischer Leistungen anbieten. Dies dient der Planung einer «bedarfsgerechten SpitalversorgungExterner Link«, was auch Kosten sparen soll.
Ärzte werden überwacht
Die Krankenkasse (Grundversicherung) muss nur für wirksame und wirtschaftliche LeistungenExterner Link aufkommen. Welche dies sind, ergibt sich aus den rechtlichen Bestimmungen sowie aus Listen. Im Streitfall muss ein Gericht klären, ob die Krankenkasse für eine bestimmte Behandlung oder ein Medikament aufkommen muss.
Die Preise, welche Ärzte oder andere medizinische Leistungserbringer verrechnen dürfen, sind klar festgelegt, sei es in staatlich genehmigten TarifverträgenExterner Link zwischen Kassen und Leistungserbringern, im Gesetz oder durch eine Behörde. Im ambulanten Bereich gilt momentan der Einzelleistungstarif «Tarmed»Externer Link, im stationären Bereich hingegen wird mit Fallpauschalen abgerechnet (SwissDRGExterner Link).

Mehr
Funktioniert das Schweizer Gesundheitswesen?
Im Rahmen der so genannten Wirtschaftlichkeitsprüfungen überwachen die Krankenkassen die frei praktizierenden Ärzte. Wer statistisch auffällig wird – also durch Verschreibungen und Behandlungen mehr Kosten verursacht als vergleichbare Ärzte – muss mit einem Verfahren rechnen und allenfalls Honorare zurückbezahlen. Damit soll eine «ÜberarztungExterner Link» verhindert werden. Für selbständig erwerbstätige Ärzte – zum Beispiel Hausärzte, Dermatologen oder Frauenärzte – bedeutet das ein nicht unerhebliches unternehmerisches Risiko, da auch schon Millionenbeträge zurückgefordert wurdenExterner Link.
Die Schweiz ist auf das Ausland angewiesen
Die abschreckende Wirkung des unternehmerischen Risikos ist auch deshalb relevant, weil es in der Schweiz zu wenig medizinisches Personal gibt – besonders gravierend ist der Mangel bei Hausärzten, Hebammen und Pflegern. Die Schweiz ist deshalb auf ausländisches Personal angewiesen, was unter anderem wegen unterschiedlichen Ausbildungsniveaus als problematisch gilt.
Verschärft haben den Personalmangel zwei Dinge: Der Numerus Clausus und der Ärztestopp. In den Fächern Humanmedizin, Zahnmedizin, Veterinärmedizin oder Chiropraktik gilt an Schweizer Universitäten eine Zulassungsbeschränkung: Die Studienplätze werden an jene Bewerber verteilt, die im Eignungstest für das Medizinstudium (EMS)Externer Link am besten abschneiden.
Mit «Ärztestopp» wird die umstrittene Massnahme des Bundesrates bezeichnet, der 2002 erstmals eine befristete Begrenzung der Neuzulassungen von Ärzten in der Schweiz beschloss, um das Wachstum der Gesundheitskosten zu stoppen (Je höher die Ärztedichte, desto höher die Gesundheitskosten). Der aktuelle Ärztestopp läuft 2019 aus. Parlament und Regierung streiten derzeit über eine Nachfolgeregelung.
Es gibt verschiedene Modelle von Gesundheitswesen: Manche Länder (beispielsweise Grossbritannien, Italien, Dänemark, Kuba) haben einen nationalen Gesundheitsdienst, der sich aus Steuermitteln finanziert. In anderen Ländern – allen voran in den USA – gilt freie Marktwirtschaft, finanziert wird alles über private Krankenversicherungen. Im so genannten Sozialversicherungsmodell (Deutschland, Frankreich) läuft die Finanzierung über eine gesetzliche Pflichtversicherung.
Für die Patienten hat jedes Modell Vor- und Nachteile. In Grossbritannien beispielsweise bezahlen Patienten zwar keine Prämien oder Arztrechnungen, weil alles über die Steuern finanziert wird, dafür müssen sie lange Wartezeiten, weite Wege und teilweise schlechte Versorgung in Kauf nehmen. MedienberichteExterner Link machen auf desolate Zustände aufmerksam – dass beispielsweise Patienten versterben, während sie auf einen Arzttermin warten.
Versicherungsmodelle wie in der Schweiz hingegen gelten als teuer und ungerecht, weil die finanzielle Beteiligung der Patienten an den Gesundheitskosten nicht einkommensabhängig ist.
Kontaktieren Sie die Autorin @SibillaBondolfi auf FacebookExterner Link oder TwitterExterner Link.

Mehr
Was Sie über Krankenkassen und Prämien im Ausland wissen müssen

In Übereinstimmung mit den JTI-Standards









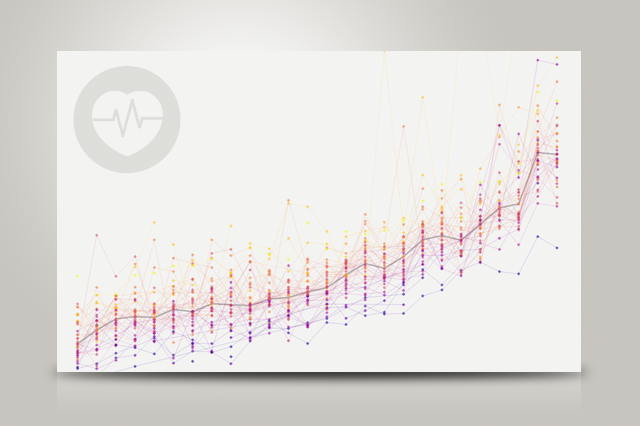





Einen Überblick über die laufenden Debatten mit unseren Journalisten finden Sie hier. Machen Sie mit!
Wenn Sie eine Debatte über ein in diesem Artikel angesprochenes Thema beginnen oder sachliche Fehler melden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an german@swissinfo.ch