Als die Schweiz den Franken floaten liess

1973 verabschiedete man sich endgültig vom Goldstandard, Wechselkurse verloren ihre Stabilität – was das mit der Schweiz machte.
Anfang dieses Jahres vermeldete die Schweizer Nationalbank ein Rekorddefizit von 132 Milliarden Franken. Angehäuft hat sie dies in ihrem Kampf gegen die Aufwertung des Frankens: Unter anderem, weil sie Fremdwährungen kaufen musste, um einem Run auf den Franken entgegenzuwirken.
Die starke Abhängigkeit der Schweizer Volkswirtschaft von der Nationalbank ist historisch gesehen neu. Sie begann im Januar vor 50 Jahren, als sich die Schweiz von fixen Wechselkursen verabschieden musste. Swissinfo hat mit zwei Historikern über diesen Umbruch gesprochen.
PLACEHOLDERAbschied vom Gold
Historiker:innen bezeichnen die Jahre nach 1945 bis Mitte der 1970er Jahre als «Wirtschaftswunderjahre». Das Ende des Booms wird an einem fixen Datum festgemacht: dem Zusammenbruch des internationalen Währungssystems von Bretton Woods.
Das Abkommen von Bretton Woods, das 1944 an einer UNO-Konferenz von 44 Ländern beschlossen wurde, hatte zum Ziel, die internationalen Währungsschwankungen zu minimieren. Es legte einerseits das Verhältnis des Dollars zum Gold fest. Andererseits verpflichteten sich alle Nationen, ihre Währung durch ihre Geldpolitik – insbesondere Käufe und Verkäufe von Dollars – zu stabilisieren.

Denn die internationale Währungspolitik nach 1945 war geprägt vom Wunsch nach Stabilität und Planbarkeit. Für den Wirtschaftshistoriker Tobias Straumann war Bretton Woods eine Art verlängerte Kriegswirtschaft: «Nach dem Ersten Weltkrieg war man sehr schnell zur liberalen Wirtschaftsordnung des 19. Jahrhunderts zurückgekehrt – was mit dem grossen Crash von 1929 endete. Nach dem Zweiten Weltkrieg war man darum vorsichtiger und zögerte den Übergang in die Friedenswirtschaft hin.»
Doch dieses System bröckelte in den späten 1960er Jahren. Die USA konnten das Versprechen, jeden Dollar in Gold einlösen zu können, nicht mehr aufrechterhalten. 1971 kündigte Präsident Nixon den Goldstandard auf.
Für Straumann war das «der grösste Einschnitt der Geldgeschichte: Seit damals gibt es nur noch bedrucktes Papier. Man kann sich unbegrenzt verschulden», sagt er. Die Bindung ans Edelmetall hatte dies zuvor eingeschränkt.»
Die Schweiz hatte sich seit den 1960er Jahren stark für dieses Währungssystem fixer Wechselkurse eingesetzt. Max Iklé, damals Mitglied des Direktoriums der SNB betonte 1962, dass es ihm dabei auch um eine Korrektur des Rufs der Schweiz ging. Es sei ja sicher allen schon aufgefallen, «dass unsere Banken mit ihrem grossen internationalen Geschäft von ihrer ausländischen Konkurrenz mit scheelen Augen angesehen» würden. Sogar der amerikanische Präsident bezeichne die Schweiz als «tax haven». Auch in der Währungspolitik gelte: «Reichtum verpflichtet.»
Doch Ende Januar 1973 scherte die Schweiz aus. Eine Währungskrise in Italien hatte erneut zu einem Anlegersturm auf den Franken geführt. Der Schweizer Finanzminister Nello Celio teilte mit, die Nationalbank werde im Moment keine Dollar mehr aufkaufen und den Franken dem Markt überlassen.
Man stabilisierte den Franken nicht mehr mit Zu- und -verkäufen von Dollars. Damit läutete die Schweiz auch das währungspolitische Ende der Nachkriegsordnung ein – sie liess ihre Währung als erstes Land «floaten».
Devisenbannwarte als Währungs-Floater
Dahinter grosse strategische Überlegungen zu vermuten, wäre falsch. Bundesrat wie Nationalbank gingen davon aus, dass man nur kurzfristig mit Dollarankäufen aussetzte, um dann später wieder einzusteigen. Noch 1971 hielt der damalige Präsident der Schweizer Nationalbank, Fritz Leutwiler, flexible Wechselkurse für schlichtweg «utopisch».
Selbst als der Übergang dazu beschlossene Sache war, meinte er zu einem Kollegen, er habe «keine Ahnung, wie man Geldpolitik unter flexiblen Wechselkursen macht». Aber Leutwiler wurde zum Spezialisten darin, Kapitalflüsse in die Schweiz abzuwehren. «Die machten etwas, das sie gar nicht wollten, und mussten die ganze Zeit improvisieren», sagt Straumann.

Tatsächlich war die SNB selbst nicht allzu überzeugt von ihrem Alleingang. Bereits 1975 erwog man, sich dem Europäischen Wechselkursverbund anzuschliessen, der so genannten «Schlange im Tunnel». Es handelte sich um ein sogenanntes Blockfloating der EG-Mitgliedstaaten. «Das war für diese sowas wie ein Trainingslager für den Euro,» stellt Jakob Tanner, emeritierter Professor für Geschichte an der Universität Zürich fest. «Hier entstand die Idee, dass man die Unsicherheiten des Floatings nur umgehen kann, wenn man die Wechselkurse innerhalb eines stabilen Blocks abschafft, was 1979 mit dem «Europäischen Währungssystem» verstetigt wurde.»
Doch der Beitritt scheiterte an Frankreich, das einen Block von Hartwährungsländern um die Deutsche Mark verhindern wollte, und nicht zuletzt, weil Kritik am Bankgeheimnis in den Raum gestellt wurde.
Die Industrie und flexible Wechselkurse
Angeklopft hatte die Schweiz bei den Europäern, weil ihr Franken als Folge seiner Freisetzung drastisch an Wert gewann – mit Folgen für die Exportindustrie. Von 1970 bis 1980 schrumpfte die Beschäftigung im Industriesektor in der Schweiz von 40% auf 32%. Dass es zu keiner Massenarbeitslosigkeit kam, war nur der Rücksendung ausländischer Arbeitskräfte und der Entlassung von Frauen im Nebenerwerb geschuldet. Die Gewerkschaften machten für den Abschwung vor allem die neue Währungspolitik verantwortlich.
Zu behaupten, die Schweiz sei deswegen mit der Zeit zu einer deindustrialisierten Zone geworden, wäre falsch: Der Anteil von produzierenden Betrieben am BIP liegt heute mit etwas über 25% vor Deutschland (24%), Italien (22%) oder Frankreich (16%).
Aber der hohe Wechselkurs des Frankens hat die Produktionsstruktur der Industrie verändert. Jakob Tanner sagt dazu: «In der Schweiz überlebten vor allem Branchen, die sich dem harten Preiswettbewerb entziehen konnten. Wenn ein Hersteller im Berner Oberland mit Spitzentechnologie Ventile herstellt, dann ist es nicht so zentral, wenn sich deren Preis verdoppelt, weil sie in Maschinen eingesetzt werden, die Millionen kosten – wichtiger sind Qualität und internationaler Service.»
Straumann sieht das ähnlich: «Ein kontinuierlicher Aufwertungsdruck zwingt die Wirtschaft, sich zu spezialisieren und zu innovieren.» Zugleich sieht er aber eine Gefahr darin, dass «wir am Schluss nur noch Luxusprodukte produzieren, wie Uhren und spezialisierte Pharmaprodukte».
Machtzuwachs der Nationalbank
Ganz konzeptlos operierte die SNB indes nicht. 1974 begann die SNB damit, die Gesamtgeldmenge für das nächste Jahr zu prognostizieren: «Man konnte dadurch eine gewisse Verankerung vermitteln. Man versorgte das Wirtschaftswachstum mit Geld,» erzählt Straumann.
Doch der Franken stieg weiter drastisch an.
1975/76 sank das Bruttoinlandprodukt der Schweiz um 7.15%, was selbst in den krisengeschüttelten 1970ern einen Weltrekord darstellte. 1978 dann schnellte der Frankenwert innerhalb von neun Monaten um 30% gegenüber dem Dollar hoch. «Friedman hat unterschätzt, wie stark Wechselkurse fluktuieren. Die dachten, der Markt passe dann die Währungskurse schön an. Sie rechneten nicht mit den Ausschlägen der 1970er-Jahre,» sagt Straumann.

Mehr
Währungskrise: Die Lehren aus den 1970er-Jahren
Zunächst wollte man zu alten Rezepten greifen, etwa das Kapital, das in die Schweiz fliesst, kontrollieren – doch das schlug wenig an. Nicht nur der Dollar schwächelte, auch die Deutsche Mark, die lange eine Leitwährung war für den Franken.
Die Nationalbank musste neue Wege gehen und kommunizierte erstmals eine Richtlinie. Man kaufte DM mit Franken und verschob über die Nachfrage den Preis. Neu war damals, dass man eine Untergrenze kommuniziert hat, «Das Ziel, wieder mehr als 80 Rappen pro DM zu kriegen», sagt Straumann. Bis die Devisenhändler:innen das akzeptierten. Man führte einen Mindestkurs ein und verteidigte diesen mit Währungskäufen – eine Strategie, die später immer wieder zum Einsatz kam.
Mit dem Floating ging zum ersten Mal die Möglichkeit einer autonomen Geldpolitik einher. Dadurch wurde die Nationalbank zu einem entscheidenden Player in einem Bereich, in dem das Parlament nichts zu sagen hat. «Es gibt natürlich gute Gründe für eine unabhängige Notenbank», sagt Historiker Jakob Tanner. «Das verhindert, dass sie zum Spielball von Verbands- und Sonderinteressen wird.
Doch seit dem Übergang zu flottierenden Wechselkursen ist die Nationalbank von einem kleinen exklusiven Club zu einer Grossorganisation mit eigener Forschungsabteilung geworden. Sie übernimmt eine riesige Verantwortung für die gesamte Wirtschaftspolitik. Deshalb müsste sie demokratisch rechenschaftspflichtig gemacht werden. Die Unabhängigkeit schliesst das nicht aus. «

Mehr
Wie die Nationalbank den Reichtum der Schweizer verwaltet

In Übereinstimmung mit den JTI-Standards











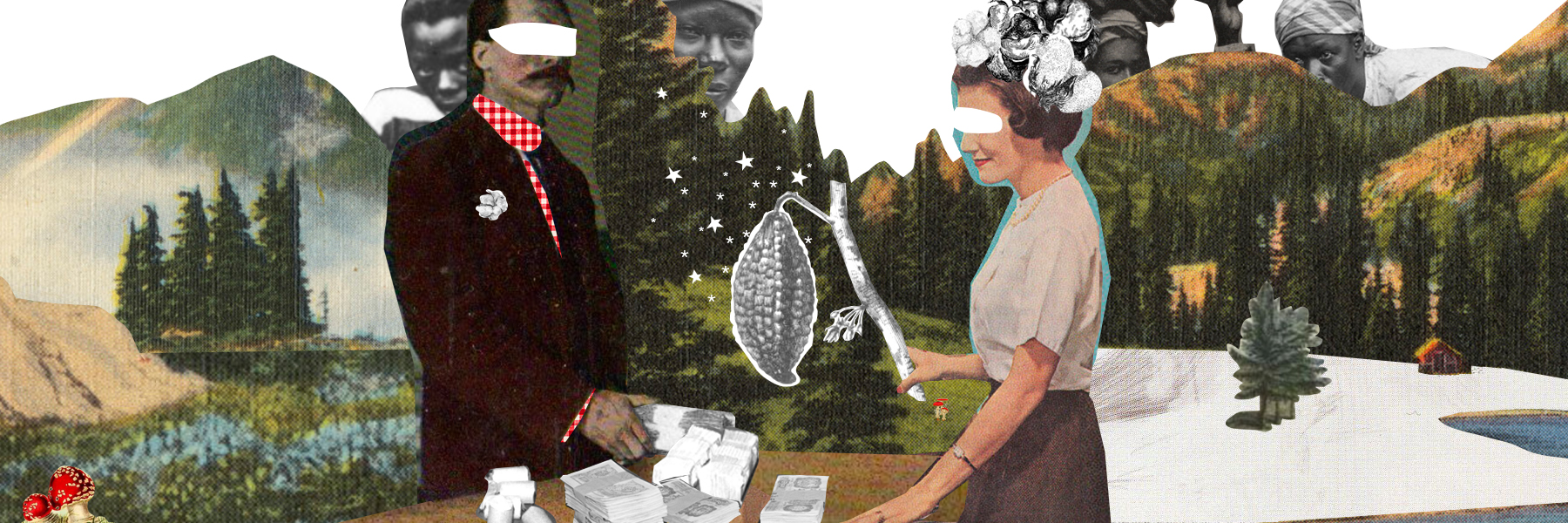
Einen Überblick über die laufenden Debatten mit unseren Journalisten finden Sie hier. Machen Sie mit!
Wenn Sie eine Debatte über ein in diesem Artikel angesprochenes Thema beginnen oder sachliche Fehler melden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an german@swissinfo.ch