Rätoromanischer Song auf internationaler Tribüne

Die rätoromanische Liedermacherin Rezia Ladina hofft, dass ihre Teilnahme an einem Wettbewerb für Lieder in Minderheitensprachen dazu beitragen wird, das Bewusstsein für das Rätoromanische, die vierte Landessprache der Schweiz, zu stärken.
Ladina belegte unter den 12 Finalisten den 7. Rang beim Liet International Song Contest in Udine (Italien), einer Musik-Veranstaltung, die Ähnlichkeiten mit dem Eurovision Song Contest hat.
Die Sängerin aus dem Unterengadin trat gegen Musiker und Musikerinnen aus Europa an, die alle auch in teilweise bedrohten Sprachen sangen, darunter Gälisch, Asturisch und Samisch.
Rätoromanisch (auch als Rumantsch oder Romanisch bezeichnet) ist eine Sprache, die auf das Lateinische zurückgeht. Sie ist für weniger als ein Prozent der Schweizer Bevölkerung die Mutter- oder Haupt-Umgangssprache. «Beheimatet» ist das Rätoromanische im Kanton Graubünden.
Die 22 Jahre alte Rezia Ladina trat bei dem Final am vergangenen Wochenende in Udine mit dem Lied «Id es capital» (Es geschah) an. Siegerin wurde eine Musikerin aus den Niederlanden mit einem Lied in Friesisch.
Vor dem Final erklärte Ladina im Gespräch mit swissinfo.ch, sie sei überzeugt, eine Verbindung zum Publikum aufbauen zu können, auch wenn nur wenig Leute die Worte ihrer Lieder verstehen könnten.
«Ich spreche ernsthafte Dinge an, wie Gewalt», sagte Ladina, deren Musik als eklektisch mit einem Einfluss von Jazz bezeichnet wird. «Die Botschaft ist: Aggression kommt zwar überall in unserer Umwelt vor, wir müssen aber nicht einfach hinnehmen, was passiert.»
«Auch wenn es kein Party-Song ist, hoffe ich, dass das Publikum sich vom Lied, von meiner Stimme und den Instrumenten berührt fühlen wird», erklärte sie weiter.
Die achte Ausgabe des Liet International Song Contest wurde von der Stadt Udine im Nordosten Italiens ausgerichtet. Udine ist ein Zentrum der Minderheitensprache Friaulisch (Furlan), die von etwa 800’000 Leuten gesprochen wird. Furlan gehört zur gleichen Sprachengruppe wie das Rätoromanische.
Erste Schweizer Teilnahme
Ladina konnte die Schweiz am Liet International Song Contest vertreten, nachdem sie sich in der der erstmals durchgeführten nationalen rätoromanischen Vorrunde durchgesetzt hatte.
«Es freut mich sehr, dass zum ersten Mal jemand aus der Schweiz mitmacht», sagte Onno Falkena, Koordinator des Liet International Contest, bei einer Pressekonferenz vor dem Wettbewerb.
Ladina habe bei der internen Ausmachung in der Schweiz beim Publikum wirklich einen guten Eindruck hinterlassen. Er freue sich darauf, zu sehen, wie das Publikum in Italien reagieren werde.
Der europaweite Wettbewerb entwickelte sich aus einer ähnlichen Veranstaltung in den Niederlanden mit Songs in Friesisch heraus. Friesisch wird im Norden der Niederlande gesprochen, von rund 600’000 Menschen.
Die Organisatoren sagen, die Daseinsberechtigung für Liet International sei im Verlauf der Jahre noch stärker geworden. Der bekanntere Eurovision Song Contest hat vor nicht allzu langer Zeit die Vorgabe aufgegeben, dass alle Teilnehmer oder Teilnehmerinnen mit einem Lied in ihrer nationalen Sprache antreten müssen.
Der Eurovision Song Contest sei heute praktisch einsprachig Englisch geworden, sagte Falkena weiter. «Es ist wirklich ein Irrtum, dass die Songtexte zeitgenössischer Musik in Englisch sein sollten. Jedes Jahr sehen wir hier bestätigt, dass diese [Minderheiten]-Musik Aufmerksamkeit verdient, und der Wettbewerb eine lohnenswerte und interessante Veranstaltung ist.»
Kritiker weisen gleichzeitig darauf hin, dass Protagonisten von Minderheitensprachen wie Wepsisch in einer globalisierten Welt immer weitere Isolierung drohe. Wepsisch ist eine finno-ugurische Sprache, die heute noch von etwa 6000 Menschen im russischen Karelien gesprochen wird.
Und der Gewinner ist …
Zurück zum Final des Liet International: Eine Jury aus 12 Vertretern der Musik-Industrie der Teilnehmerstaaten bestimmte den Gewinner respektive die Gewinnerin. Dabei kam ein ähnliches Punktesystem zum Zug wie beim Eurovision Song Contest.
Janna Eijer aus den Niederlanden landete auf dem ersten Platz und erhielt ein Preisgeld von 2000 Euro (2481 Franken). Die österreichische Band Coffeeshock Company, die in Burgenland-Kroatisch singt, gewann die Publikumswahl – Publikum im Saal und Stimmen des Fernsehpublikums –, und ein Preisgeld von 1000 Euro.
Ladina landete auf dem siebten Platz. Sie plant, auch in Zukunft mit Liedern mit rätoromanischen Texten aufzutreten. Sie nehme sich diese Freiheit. «So kann ich ausdrücken, was ich fühle und weiss, dass es etwas wirklich Persönliches werden kann», erklärte sie.
Sie hoffe, dass in Zukunft auch mehr Musikliebhaber in der Schweiz nach rätoromanischer Musik Ausschau hielten. «Öffnet die Ohren, denn es ist eine grossartige Sprache für Musik», unterstreicht sie.
«Das nächste Mal, wenn jemand portugiesische, italienische oder spanische Musik sucht, sollte er oder sie sich auch mal Musik in Rumantsch anhören, die kommt sogar aus dem eigenen Land.»
Die achte Ausgabe des Liet International Song Contest für Minderheiten-Sprachen fand vom 17. bis 20. November in Udine, Italien, statt, mit dem grosse Finale am 19. November.
Organisiert und veranstaltet wurde der Wettbewerb von der Friaulischen Regionalorganisation Arlef in enger Zusammenarbeit mit der Stiftung Liet International in den Niederlanden.
Der Songcontest für Minderheitensprachen, der einzige seiner Art, wurde vom Europarat unterstützt, der auch eine Charta für Regional- und Minderheitensprachen hat.
Die Schweiz hat diese Charta 1997 ratifiziert, im Jahr darauf trat sie in Kraft.
Rätoromanisch/Romantsch ist neben Deutsch, Französisch und Italienisch die vierte Landessprache der Schweiz.
Sie wird im Kanton Graubünden von etwa 70’000 Menschen gesprochen. Daneben findet man die rätoromanische Diaspora vor allem in Zürich.
Rätoromanisch ist seit der Zeit der Reformation eine geschriebene Sprache.
Von Anfang an haben Übersetzer der Bibel und religiöse Apologeten sich darum bemüht, in lokalen Idiomen zu schreiben.
Heute gibt es fünf rätoromanische Idiome mit ihrer jeweils eigenen Schriftform und Literatur. Die fünf Idiome hängen je mit einer Region Graubündens zusammen: Sursilvan (Vorderrhein), Sutsilvan (Hinterrhein), Surmiran (Alvratal und Gelgiatal), Puter (Oberengadin) sowie Vallader (Unterengadin und Münstertal).
Seit 1982 gibt es eine überregionale Sprache, das Rumantsch Grischun mit einer standardisierten Schriftversion.
Rumantsch Grischun hat aber einen schweren Stand und stösst bis heute auf Widerstand in Teilen der Rätoromanisch sprechenden Bevölkerung.
Rumantsch Grischun wird aber von der rätoromanischen Tageszeitung La Quotidiana für viele ihrer Artikel verwendet und auch in den Nachrichtensendungen von RTR, dem öffentlich-rechtlichen rätoromanischen Radio und Fernsehen.
Auf Widerstand stösst bis heute auch der Plan, an den Primarschulen im Kanton Graubünden Rumantsch Grischun als Unterrichtssprache einzuführen.
(üUbertragung aus dem Englischen: Rita Emch)

In Übereinstimmung mit den JTI-Standards










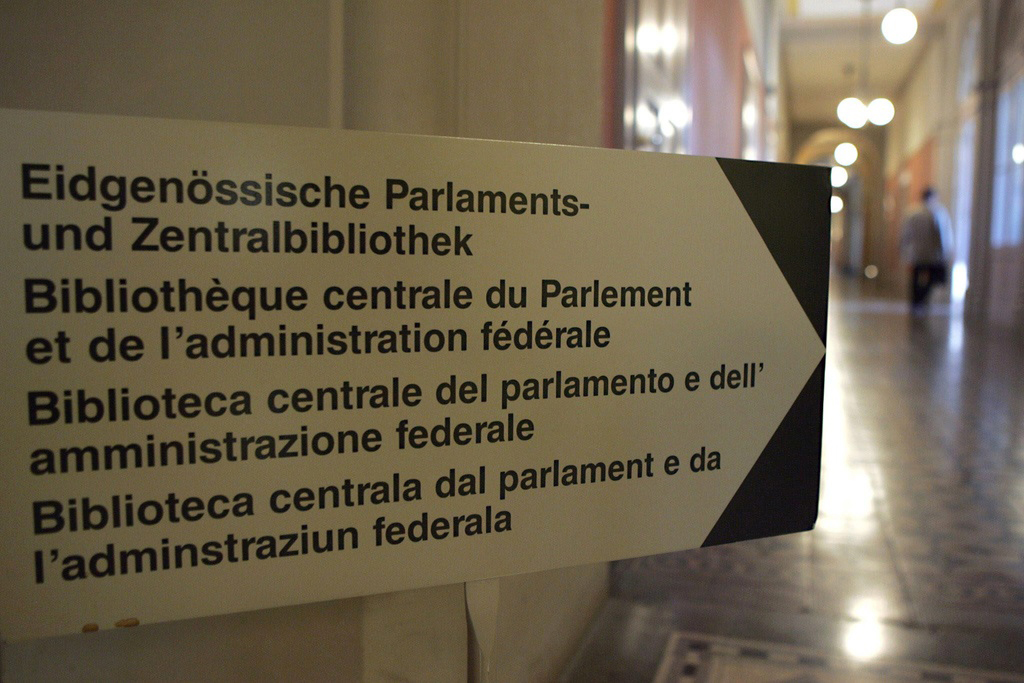



Einen Überblick über die laufenden Debatten mit unseren Journalisten finden Sie hier. Machen Sie mit!
Wenn Sie eine Debatte über ein in diesem Artikel angesprochenes Thema beginnen oder sachliche Fehler melden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an german@swissinfo.ch