Zürich ehrt den Schriftsteller zum 100. Geburtstag
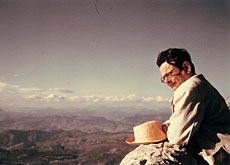
Geboren wurde er in Bulgarien, gelebt hat er in England, Österreich, Deutschland und der Schweiz. 1981 erhielt Elias Canetti den Nobelpreis für Literatur.
Die Ausstellung «Das Jahrhundert an der Gurgel packen» im Strauhof Zürich verschafft Einblick in ein spannendes Leben.
Elias Canetti hat Zürich geliebt: Hier hat der älteste Sohn sephardischer Juden als Kind und Jugendlicher eine glückliche Zeit und die letzten Jahre seines Lebens verbracht. In Zürich liegt er auch begraben – neben James Joyce.
Vieles liegt noch verborgen
Literaturausstellungen sind nicht selten eine trockene Angelegenheit: Vergilbte Papiere, verblasste Fotos und eine Fülle erklärender Tafeln. Nicht so die Ausstellung «Das Jahrhundert an der Gurgel packen» des Canetti-Biografen Sven Hanuschek. Sie verführt den Besucher, die Besucherin in die Welt eines herausragenden Denkers und Analytikers.
Canetti hatte seinen Nachlass kurz vor seinem Tod im Jahr 1994 der Zürcher Zentralbibliothek vermacht, allerdings mit Auflagen: Die Forschung sollte erst 10 Jahre nach seinem Tod Einsicht in seinen literarischen Nachlass (120 Schachteln) erhalten. Der private Nachlass (30 Schachteln) mit Briefen und Korrespondenzen bleibt noch bis 2024 verborgen.
«Dass andere an meinem Leben herumfingern werden, erfüllt mich mit Widerwillen. Unter ihren Händen wird es ein anderes Leben werden. Ich will es aber so haben, wie es wirklich war. Ein Mittel finden, sein Leben so zu verbergen, dass es nur für die sichtbar wird, die klug genug sind, es nicht zu entstellen» schrieb Canetti.
Multimedialer Zugang
Die Zürcher Ausstellung wurde sehr sorgfältig und abwechslungsreich gestaltet. Im ersten Raum sind auf roten Säulen die verschiedenen Stationen von Canettis bewegtem Leben festgehalten: Von Rustschuk im heutigen Bulgarien über Manchester, Frankfurt und Wien bis nach Zürich.
Besonders interessant sind die Tondokumente: Zum Beispiel wenn Canetti mit eindringlicher, unverkennbarer, leicht schriller und belehrender Stimme über die Zielstrebigkeit der Masse referiert, die «wie ein Feuer alle erfasst und die Menschen von ihrer Berührungsfurcht erlöst, solange ein gemeinsames, noch unerreichtes Ziel vorhanden ist».
Man spürt, wie tief sich der Wissenschafter Canetti mit diesem Thema auseinandergesetzt hat und kann nur ahnen, wie er, lebte er noch, den millionenfachen Massenaufmarsch von Pilgern nach dem Papsttod in Rom hätte verstehen und erklären wollen.
Dem Thema «Masse und Macht», von dem Canetti richtiggehend besessen war, ist ein ganzer Raum gewidmet. Ein Videofilm zeigt den Brand des Justizpalastes in Wien im Jahr 1927, ein Schlüsselerlebnis im Leben des Schriftstellers.
Über Jahrezehnte hinweg befasste er sich mit dem Verhalten von Menschenmassen, über 20 Jahre lang schrieb er an seinem anthropologischen Grossessay «Masse und Macht», das 1960 veröffentlicht wurde.
Der Tod – sein Erzfeind
Das zweite Thema, das den Nobelpreisträger sein Leben lang begleitete, war der Tod. Canetti selbst vermutete, dass der plötzliche Tod seines Vaters, den er als kleiner Junge als Schock erlebte, der Grund für seinen Zwang war, gegen den Tod, seinen Todfeind, anzukämpfen. Er bezeichnete den Tod als die sinnloseste Einrichtung im menschlichen Leben.
Elias Canetti konnte erst im Alter von etwa 65 Jahren von seinen Büchern leben, lange Zeit war er ein Geheimtipp geblieben. Sofort zum Bestseller wurde seine autobiografische Trilogie, deren erster Teil («Die gerettete Zunge») 1977 erschien. 1980 folgte «Die Fackel im Ohr», 1985 «Das Augenspiel».
Lebenslänglich im Exil
Canetti, Sohn jüdischer Eltern, geboren mit türkischem Pass, zeitweilig staatenlos, erhielt später die britische Staatsbürgerschaft und starb in Zürich. «Man wird, was man war, erst ganz in der Emigration», hat er einmal geschrieben.
Der Weltenbürger galt als kauziger Typ, nicht immer angenehm, der in allen Lebensstationen seine Kontakte gepflegt und auch etliche Frauenherzen gebrochen haben soll.
Er war zweimal verheiratet und wurde mit fast 70 Vater einer Tochter. Canetti hatte wohl viele Gesichter – einige davon kann man in Zürich sehen.
swissinfo, Gaby Ochsenbein
25. Juli 1905: Elias Canetti wird in Rustschuk, Bulgarien, geboren.
1911: Umzug nach Manchester
1912: plötzlicher Tod des Vaters
1913: Umzug nach Wien
1916-1920: Elias Canetti geht in Zürich zur Schule
1921-1924: Gymnasium in Frankfurt
1924–1929: Chemie-Studium in Wien
1931: Canettis erstes Buch «Die Blendung»
1934: Heirat mit Veza Taubner
1937: Tod der Mutter
1938: Flucht nach England
1960: Canettis Hauptwerk «Masse und Macht» erscheint
1963: Tod von Veza Canetti
1971: Canetti heiratet Hera Buschor
1972: Geburt der Tochter und Umzug nach Zürich
1972: Verleihung Georg Büchner-Preis
1976–1985: Dreiteilige Autobiografie erscheint
1981: Canetti erhält den Nobelpreis für Literatur
1988: Tod Hera Canettis
14. August 1994: Elias Canetti stirbt in Zürich
Trotz vieler Kontakte, Beziehungen und grosser Begabung galt Elias Canetti als widersprüchlicher und eigensinniger Mensch.
Erst im Alter von 65 konnte er von seinen Büchern leben. Sein Hauptwerk war «Masse und Macht». Mit dem Thema Massenphänomen befasste er sich über Jahrzehnte hinweg. Er war ein ausgezeichneter Beobachter und Analytiker.
Die Ausstellung im Strauhof Zürich dauert bis zum 29. Mai 2005.

In Übereinstimmung mit den JTI-Standards












Einen Überblick über die laufenden Debatten mit unseren Journalisten finden Sie hier. Machen Sie mit!
Wenn Sie eine Debatte über ein in diesem Artikel angesprochenes Thema beginnen oder sachliche Fehler melden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an german@swissinfo.ch