«Die Schweiz sollte mehr Vertrauen haben»

Die Schweiz hat eines der strengsten Einbürgerungsgesetze Europas. Laut Brigitte Studer hat das Land Ausländer stets als vorübergehende Arbeitskräfte angesehen, nicht als zu integrierende Bürger. In ihrem Buch "Das Recht, Schweizer zu sein" zeichnet die Historikerin die Entwicklung des schweizerischen Verhältnisses zur Staatsbürgerschaft nach.
swissinfo.ch: Die Schweiz hat eine der strengsten Gesetzgebungen Europas in Sachen Einbürgerung. Bei der Staatsgründung 1848 war sie jedoch ziemlich freizügig mit Einbürgerungen. Was bedeutet es also, Bürger oder Bürgerin zu sein?
Brigitte Studer: Die Eidgenössische Verfassung von 1848 führte das Recht auf Staatsbürgerschaft ein, aber die Eidgenossenschaft gab den Kantonen und Gemeinden freie Hand bei Einbürgerungen. Damals war die Staatsbürgerschaft aus liberaler Optik ein Instrument für Männer, als Wähler und Abstimmende am politischen Leben teilnehmen zu können.
Die liberale Praxis einiger Kantone bei Einbürgerungen erregte jedoch den Zorn der Nachbarländer. Einige Ausländer nahmen nämlich die Schweizer Staatsbürgerschaft an, obwohl sie nicht einmal hier lebten, um in ihrem Heimatland dem Militärdienst zu entkommen. Die Eidgenossenschaft sah sich gezwungen einzuschreiten. Sie tat es aber in moderater Weise und verlangte lediglich, dass die Gesuchsteller mindestens zwei Jahre im Land gelebt hatten.

swissinfo.ch: Der Erste Weltkrieg läutete einen Wechsel ein. Mit welchen Konsequenzen?
B.S.: Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurde mit dem Aufschwung von nationalistischen Bewegungen die Bürgerschaft plötzlich zum Thema. In die republikanische Denkart, gemäss derer die Integration von Ausländern notwendig ist zur Verhinderung von Parallelgesellschaften, tritt ein nationalistischer Diskurs ein. In dieser Zeit entsteht der Begriff Überfremdung sowie das Gefühl, die Schweiz müsse ihre Grenzen schützen.
Der Krieg akzentuiert den Nationalismus noch mehr, nicht nur in der Schweiz. Im Jahr 1917 gründet die Schweiz die Ausländerpolizei und 1930 verankert sie das Verteidigungsprinzip im «Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer».
swissinfo.ch: Wovor fürchtete sich die Schweiz?
B.S.: Zu Beginn des Jahrhunderts fürchtete man vor allem die russische Revolution und den Vormarsch der Kommunisten. Später machte die Wirtschaftskrise Angst sowie das Schreckgespenst des Ausländers, der einem die Arbeit raubt.
Am meisten beschränkte die Schweiz den Zugang zur Staatsbürgerschaft während des Zweiten Weltkrieges. Der Bundesrat führte sogar die Möglichkeit des Widerrufs der Nationalität ein und zwar per Dekret, das nicht vom Parlament genehmigt werden muss. Das war eine besonders starke Geste.
swissinfo.ch: Wann kam in der Schweiz die Rhetorik des «echten Schweizers» und der «helvetischen Werte» auf?
B.S.: Es ist ein langer Prozess, der seinen Ursprung im 20. Jahrhundert findet. Die Kantone führten in das Einbürgerungsverfahren die Überprüfung der Einstellungen des Kandidaten ein. Zuvor war das wichtigste Kriterium die finanzielle Unabhängigkeit gewesen. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg – als die Schweiz bewusster demokratisch wurde – wurden die staatsbürgerlichen und politischen Kenntnisse beim Verfahren berücksichtigt.
Im Jahr 1952 verpflichtete das neue BürgerrechtsgesetzExterner Link explizit zur Einführung von Wissenstests für die Kandidaten und setzte damit den Akzent stärker auf die Einhaltung «helvetischer Werte». Zudem wurde die Residenzpflicht auf 12 Jahre erhöht.
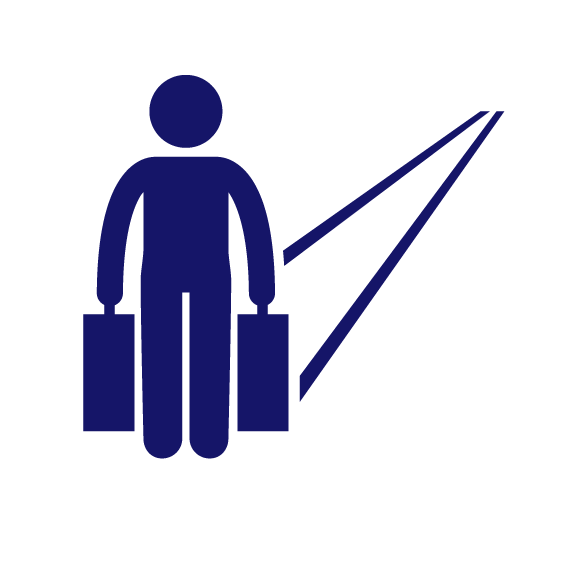
Mehr
Wie wird man Schweizer Staatsbürger*in?
swissinfo.ch: Warum sieht die Schweiz im Unterschied zu anderen Ländern die Einbürgerung als Krönung des Integrationsprozesses und nicht als Instrument zur Erleichterung der Integration?
B.S.: Die Schweiz hat sich nie als Einwanderungsland definiert. In der Regel waren es die klassischen Einwanderungsländer wie die USA oder Kanada, die sich für das Geburtsortsprinzip entschieden haben. Oder auch jene Länder wie Frankreich, welche die Geburtenrate steigern möchten. Historisch hat die Schweiz nie das Interesse gehabt, die Bevölkerung zu vergrössern. Im Gegenteil: Sie fürchtete stets ein unkontrolliertes Wachstum. Sie sieht sich als Land, in das viele Ausländer kommen, die aber nach einer Weile wieder gehen müssen. Es ist eine klare politische Haltung: Die Schweiz will die Kontrolle über die Einwanderung behalten und die Ausländer wegschicken können, wenn die Wirtschaft sie nicht mehr braucht.
swissinfo.ch: Erst in den 1970er-Jahren zeigte sich die Schweiz etwas offener…
B.S.: Ja, in den 1960er-Jahren schlug das Polizei- und Justizdepartement tatsächlich eine Vereinfachung des Einbürgerungsverfahrens vor, um den hier geborenen und gut integrierten Ausländern den Zugang zum Schweizer Pass zu erleichtern. Die vereinfachte Einbürgerung wurde als Instrument zur Bekämpfung der Überfremdung angesehen. Man darf nicht vergessen, dass zwischen 1965 und 1974 das Stimmvolk über fünf ausländerfeindliche Initiativen abstimmen musste, darunter eine, welche die Zahl der Einbürgerungen beschränken wollte. Alle wurden abgelehnt, aber einige nur mit knapper Mehrheit.
swissinfo.ch: Das Stimmvolk hat aber auch viermal die erleichterte Einbürgerung für junge Ausländer der zweiten oder dritten Generation abgelehnt. Warum?
B.S.: Der Vorschlag von Regierung und Parlament aus dem Jahr 1983 sah nicht nur die erleichterte Einbürgerung für in der Schweiz geborene Ausländer vor, sondern auch für Flüchtlinge und Staatenlose. Vor allem dieser Aspekt erregte Kritik. Im Jahr 1994 kam eine weniger ambitiöse Verfassungsreform zur Abstimmung, die von allen politischen Parteien getragen wurde. Eine Mehrheit der Stimmbürger nahm die Vorlage an, doch eine Mehrheit der Kantone lehnte sie ab, vor allem ländliche Kantone waren dagegen.
2004 lehnte das Stimmvolk eine weitere Vorlage zur erleichterten Einbürgerung von jungen Ausländern der zweiten Generation sowie die automatische Schweizer Staatsbürgerschaft für Ausländer der dritten Generation ab. In diesem Fall war es dieses Geburtsortsprinzip, welches die Bevölkerung zu einem Nein bewog.
swissinfo.ch: Die in der Schweiz geborenen und hier aufgewachsenen Ausländer können heute schon auf dem ordentlichen Weg eine Einbürgerung verlangen. Viele machen von dieser Möglichkeit aber keinen Gebrauch. Was sind die Gründe dafür?
B.S.: Wenn man jung ist, scheut man alles Bürokratische. Das ordentliche Einbürgerungsverfahren ist langwierig und teuer. Meist müssen sich die Kandidaten vertieften Gesprächen unterziehen, die je nach Gemeinde ziemlich invasiv sind, und das ist eher entmutigend.
Es ist allerdings wahrscheinlich, dass die Gesuche dieses Jahr steigen werden, weil 2018 ein neues Gesetz in Kraft tritt, das noch strengere Regeln vorsieht.
swissinfo.ch: Am 12. Februar 2017 wird die Schweiz erneut über eine erleichterte Einbürgerung für junge Ausländer der dritten Generation abstimmen. Was wären Ihrer Meinung nach die Konsequenzen eines Neins?
B.S.: Es wäre für diese jungen Leute wie eine Ohrfeige, eine klare Mitteilung, dass die Schweizer Gesellschaft ihre Anwesenheit zwar duldet, sie aber nicht als Teil der Gesellschaft sieht. Ein Nein würde aber auch bedeuten, dass die Schweiz kein Vertrauen in ihre Integrationsfähigkeit hat. Denn wenn nicht einmal Enkel und Enkelinnen von eingewanderten Ausländern integriert sind, die ja in der Schweiz geboren wurden und hier zur Schule gingen, dann hat das Land tatsächlich ein Problem. Die Schweiz sollte mehr Vertrauen in ihre Integrationsfähigkeit haben!
(Übertragung aus dem Italienischen: Sibilla Bondolfi)

In Übereinstimmung mit den JTI-Standards













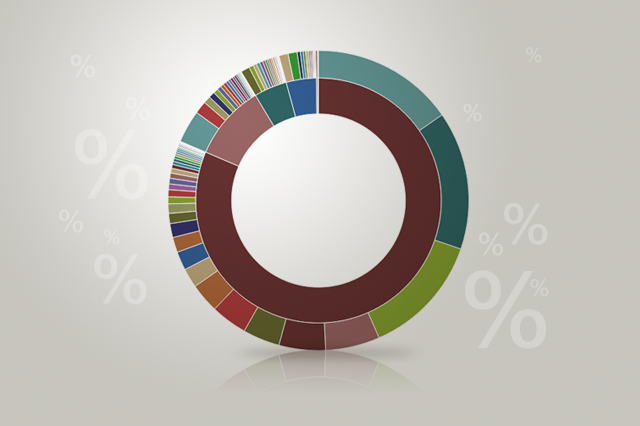




Einen Überblick über die laufenden Debatten mit unseren Journalisten finden Sie hier. Machen Sie mit!
Wenn Sie eine Debatte über ein in diesem Artikel angesprochenes Thema beginnen oder sachliche Fehler melden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an german@swissinfo.ch