«Es braucht zusätzliche Bereitschaft zu Gesprächen und Kompromissen»
Das institutionelle Rahmenabkommen zwischen der Schweiz und der EU: Der Bundesrat entscheidet bald. Es war auch Gegenstand eines Referats, das der Schweizer Botschafter in Berlin an der Tagung der Auslandschweizer in Deutschland hielt. Wir publizieren die Rede in einer gekürzten Fassung.
Das Verhältnis Schweiz-Europäische Union bildet eine Win-Win-Situation für beide Seiten.
«Die letzten Kilometer sind die schwierigsten.»
Grundlage dieses Erfolgsmodells bilden die bilateralen Abkommen zwischen der Schweiz und der EU, angefangen beim Freihandelsabkommen von 1972 sowie den beiden Vertragspaketen von 1999 und 2004, die sogenannten Bilateralen I und II. Ein Netz von rund 120 Vereinbarungen verbindet die Schweiz und die EU.

Mehr
«Wir müssen die Vorteile des europäischen ‹Klubs› noch besser erklären»
Diese garantieren vor allem den gegenseitigen Marktzugang im Handel, im Personenverkehr und bei Dienstleistungen. Mit dem Rahmenabkommen
wollen die Schweiz und die EU ein Dach über die wichtigsten bilateralen Verträge spannen. Hauptziel ist die geordnete rechtliche Weiterentwicklung der bestehenden Verträge.
«Nun – ganz so heiss wurde diese Suppe dann trotzdem nicht gegessen, wie man inzwischen weiss.»
Ein Hauptgrund für die Verhandlungen über das Rahmenabkommen ist die unterschiedliche Rechtsnatur von EU-Recht und internationalem Vertragsrecht. EU-Recht ist dynamisch und entwickelt sich fortlaufend weiter. Vertragsrecht ist vom Charakter her statisch. Ein Vertrag gilt so wie er einmal ausgehandelt wurde.
Anpassungen müssen jedesmal neu verhandelt werden.
Dies wurde der EU mit der Zeit zu umständlich. Sie hielt daher schon 2012 fest, dass für die Weiterentwicklung des bilateralen Wegs der Abschluss eines Abkommens über institutionelle Fragen notwendig sei.
Botschafter Paul Seger eröffnete seine Rede mit folgendem Witz:
Der deutsche und der schweizerische Bundespräsident dürfen vor den Lieben Gott treten, der ihnen erlaubt, eine Frage zu stellen.
Der deutsche Bundespräsident fragt: «Lieber Gott, wann werden endlich die wirtschaftlichen und sozialen Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland beseitigt sein?»
Gott überlegt lange und antwortet dann: «Nicht während Deiner Amtszeit.»
Dann fragt der schweizerische Bundespräsident: «Wann werden wir endlich der EU beitreten?»
Der Liebe Gott überlegt noch viel länger und seufzt schliesslich: «Nicht während meiner Amtszeit.»
Für den Bundesrat ist ein Abkommen im institutionellen Bereich auch wichtig, weil es den Zugang zum EU-Binnenmarkt langfristig sichert und den Ausbau der Kooperation mit der EU ermöglicht.
Müssen wir mit dem Rahmenabkommen automatisch EU-Recht übernehmen? Die Antwort lautet Nein.
Im institutionellen Abkommen verpflichtet sich die Schweiz dazu, relevante EU-Rechtsentwicklungen zu übernehmen. Sie kann aber – und das ist wichtig – über jede Anpassung einzeln beschliessen. Das Referendumsrecht wird gewahrt. Die Schweiz wird ausserdem bei der Erarbeitung der relevanten Rechtsentwicklungen in der EU systematisch konsultiert. Sie kann so ihre Anliegen frühzeitig einbringen.
Ich gehe davon aus, dass Gespräche über Klarstellungen und interpretative Erklärungen nicht ausgeschlossen sind.
Ist die Schweiz nicht bereit, eine Weiterentwicklung zu übernehmen, kann die EU das Streitbeilegungsverfahren einleiten. Solche Verfahren haben vor allem den Zweck, Differenzen zu versachlichen und zu entpolitisieren.
Finden die Schweiz und die EU innerhalb von drei Monaten keine Lösung, kann jede Partei die Einsetzung eines Schiedsgerichts verlangen. Das Schiedsgericht legt den Streit gestützt auf die Auslegung des Europäischen Gerichtshof bei. Die Parteien sind an den Schiedsspruch gebunden.
So – und jetzt kommen wir zum Kleingdedruckten: Gemeinsam mit diesen institutionellen Fragen wollte die EU nämlich ein paar materielle Punkte mit der Schweiz regeln, insbesondere die Umsetzung der Personenfreizügigkeit durch die Schweiz, die Anwendbarkeit der sogenannten Unionsbürgerrichtlinie sowie das Thema der staatlichen Beihilfen.
Das Personenfreizügigkeitsabkommen untersteht dem institutionellen Abkommen und somit der dynamischen Aktualisierung. Der Bundesrat forderte aber in drei Bereichen Ausnahmen von der Rechtsübernahme: bei den flankierenden Massnahmen, der Unionsbürgerrichtlinie sowie der Koordination der Sozialversicherungen.
Der Warenaustausch zwischen der Schweiz und der EU beträgt täglich 1 Milliarde Franken.
Gegenwärtig leben und arbeiten rund 1,4 Millionen Bürgerinnen und Bürger aus dem EU-Raum in der Schweiz. Dazu kommen im Durchschnitt 315’000 Grenzgänger täglich in die Schweiz zur Arbeit, wovon knapp 62’000 aus Deutschland.
Die Union erzielt mit der Schweiz regelmässig satte Handelsbilanz-Überschüsse in zweistelliger Milliardenhöhe. Umgekehrt hängen in der Schweiz gemäss dem Think Tank Avenir Suisse rund 860’000 Arbeitsplätze direkt und 1,3 Millionen Stellen indirekt vom Handel mit der EU ab.
Die EU vertritt dagegen den Standpunkt, dass alle Teilnehmenden am EU-Binnenmarkt den gleichen Bedingungen unterstehen müssen und generelle Ausnahmen nicht akzeptabel sind. Sie hält vor allem bestimmte flankierende Massnahmen für nicht konform mit dem Personenfreizügigkeitsabkommen und fordert seit über zehn Jahren deren Anpassung.
Der Kompromissvorschlag der EU im Vertragsentwurf sieht nun vor, dass die Schweiz relevantes EU-Recht im Entsendebereich drei Jahre nach Inkrafttreten des InstA übernimmt. Doch akzeptiert die EU gleichzeitig eine Reihe verhältnismässiger Massnahmen, die über das EU-Recht hinausgehen, um die Besonderheiten des Schweizer Arbeitsmarkts zu respektieren.
Aus meiner Erfahrung ist es mit dem Umgang mit Verhandlungsprozessen wie beim Marathon. Die letzten Kilometer sind die schwierigsten.
Ein weiterer strittiger Punkt betrifft die sogenannte Unionsbürgerrichtlinie: Die Schweiz wollte diese vom Rahmenabkommen ausschliessen. Inhaltlich sind verschiedene Punkte für die Schweiz besonders problematisch: insbesondere ein Ausbau der Sozialhilfeansprüche, die Ausweitung des Ausweisungsschutzes sowie das Daueraufenthaltsrecht ab fünf Jahren Aufenthalt.
Die EU dagegen wollte die Unionsbürgerrichtlinie eigentlich im Abkommen erwähnt haben, da sie eine Weiterentwicklung der Personenfreizügigkeit bilde. Nach dem Motto «We agree to disagree» (wir einigen uns, uneins zu sein) wird nun die Richtlinie im Abkommensentwurf weder explizit erwähnt, noch explizit ausgeschlossen. Man hat die Regelung dieser Frage auf die praktische Anwendung vertagt.

Mehr
«Die Schweiz ist in der Sackgasse, Rahmenabkommen hin oder her»
Ein letzter Punkt im Bereich der Personenfreizügigkeitsabkommen betrifft den Wechsel der Zuständigkeit für Arbeitslosenleistungen an Grenzgänger. Bis jetzt zahlt die Arbeitslosenkasse des Wohnsitzstaates. Nach dem Vorschlag des Europäischen Parlamentes könnten Arbeitnehmer neu zwischen dem Wohnort unddem Erwerbsort wählen. Eine spätere Übernahme durch die Schweiz müsste noch verhandelt werden. Sie wäre aber voraussichtlich mit erheblichen Mehrbelastungen für die Arbeitslosenversicherung des Bundes verbunden.
Ich will nicht verhehlen, dass sich die Verhandlungen zu diesem InstA schwierig gestalteten. Zum einen war das Abkommen in der Schweiz anfänglich umstritten und verschiedene Kreise zweifelten dessen Nutzen und Mehrwert an. Dazu kamen Befürchtungen hinsichtlich eines drohenden Souveränitätsverlustes der Schweiz, weil sie sich institutionell zu stark an die EU anbinde.
Im Aussenverhältnis zur EU wirkte der Umstand erschwerend mit, dass die EU-Kommission und die Mitgliedstaaten wegen der gleichzeitigen Brexit-Verhandlungen nur beschränkt bereit waren, auf schweizerische Anliegen einzugehen. Sie wollte der Schweiz offensichtlich nicht Dinge zugestehen, welche man dann auch den Briten hätte konzedieren müssen.
Zudem verknüpfte die EU-Kommission Themen mit den Verhandlungen, welche aus unserer Sicht sachfremd waren und diskriminierend wirkten: Nämlich die Anerkennung der Börsenäquivalenz und die Mitwirkung bei den EU-Forschungsprogrammen Horizon Europe.
Ferner drängte die EU die Schweiz unter Verweis auf den Brexit auf einen Verhandlungsabschluss vor Ende 2018. Anschliessend, so wurde uns beschieden, sei man komplett vom Brexit absorbiert und hätte keine Zeit mehr für uns.
Nun – ganz so heiss wurde diese Suppe dann trotzdem nicht gegessen, wie man inzwischen weiss.

Die Verhandlungen kamen vor Ende des vergangenen Jahres zum Abschluss. Vor einer förmlichen Unterzeichnung des Abkommens hat nun aber der Bundesrat den Entwurf in einer breiten Konsultation zur Diskussion gestellt. Dieser Prozess ist nun abgeschlossen.
Eine repräsentative Umfrage des Schweizer Fernsehens vom März 2019 ergab, dass rund 60% der befragten Schweizer den Abschluss eines Rahmenabkommens im Grundsatz gutheissen. Dies mag angesichts der teilweise lautstarken Opposition gegen das Abkommen erstaunen. Die Meinungsforscher bezeichneten denn auch die Zustimmung als «zähneknirschend».
Dennoch sind die Widerstände gegen das Abkommen nach wie vor erheblich. Eine kürzlich erfolgte Umfrage des «Tagesanzeigers» ergab, dass offenbar nur 20% der Befragten das Rahmenabkommen in der jetzigen Fassung akzeptierten.
Die EU hat schon klargestellt, dass die Verhandlungen zum Rahmenabkommen abgeschlossen sind. Ich gehe aber davon aus, dass dies Gespräche über Klarstellungen und interpretative Erklärungen nicht ausschliesst. Letztlich dürften auch die EU- Mitgliedstaaten, insbesondere unsere Nachbarstaaten, ein Eigeninteresse an geregelten Verhältnissen zur Schweiz haben.
Im Unterschied zur Annahme der Begrenzungsinitiative würde ein Misserfolg des Rahmenabkommens nicht das Ende unserer Vertragsbeziehungen zur EU bedeuten.
Es braucht zusätzliche Gesprächs- und Kompromissbereitschaft und zwar sowohl im Innern als auch auf der Ebene der EU. Dies alles wird sich vor dem Hintergrund der Neubesetzung der EU-Institutionen nach den Wahlen vom vergangenen Wochenende und des weiter ungewissen Brexit-Prozesses abspielen.
Dazu kommen auf der innenpolitischen Agenda die Nationalratswahlen vom Oktober 2019 sowie die Begrenzungsinitiative der SVP. Diese verlangt nichts weniger als eine Neuverhandlung bzw. Aufkündigung des Personenfreizügigkeitsabkommens mit der EU. Dies wäre, wie es die neue Bundesrätin und Justizministerin Karin Keller-Sutter formuliert hat, der «Schweizer Brexit».
Im Unterschied zur Annahme der Begrenzungsinitiative würde ein Misserfolg des Rahmenabkommens nicht das Ende unserer Vertragsbeziehungen zur EU bedeuten. Es würde dann einfach der Status Quo weitergelten. Der Preis wäre Stagnation. Der europäische Zug führe weiter, und wir riskieren, von Weiterentwicklungen, welche im Interesse unseres Wohlstandes wären, abgekoppelt zu werden.

Dies gilt beispielsweise für die Teilnahme an europäischen Forschungs- und Entwicklungsprogrammen, welche für den Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort Schweiz sehr wichtig sind. Betroffen wäre jedoch auch der Aussenhandel zum Beispiel in der Medizinal-Chemie und Pharmabranche, deren Produkte für den Export in den EU-Raum als marktkonform anerkannt werden müssen.
Die nächsten Wochen und Monate werden entscheidende Weichenstellungen für die langfristige Zukunft der Schweiz in Europa bringen. Aus meiner Erfahrung ist es mit dem Umgang mit Verhandlungsprozessen wie beim Marathon. Die letzten Kilometer sind die schwierigsten. Da heisst es die Zähne zusammenbeissen, das Tempo zu halten und das Ziel nicht aus den Augen lassen.
Die in diesem Artikel geäusserten Ansichten sind ausschliesslich jene der Autorin und müssen sich nicht mit der Position von swissinfo.ch decken.

In Übereinstimmung mit den JTI-Standards












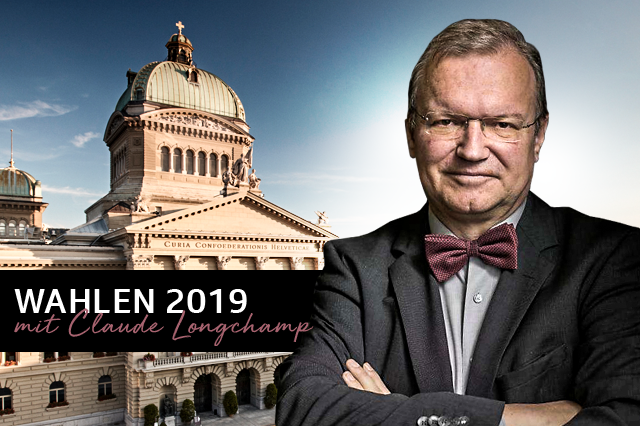
Einen Überblick über die laufenden Debatten mit unseren Journalisten finden Sie hier. Machen Sie mit!
Wenn Sie eine Debatte über ein in diesem Artikel angesprochenes Thema beginnen oder sachliche Fehler melden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an german@swissinfo.ch