Umstrittener UBS-Staatsvertrag im Parlament

Die Turbulenzen um die Grossbank UBS und deren Folgen stehen im Zentrum der am Montag beginnenden Sommersession der Eidgenössischen Räte. Weitere brisante Themen sind die Ausschaffungsinitiative der SVP und die Managerlöhne.
Als «Kompromiss zwischen zwei souveränen Rechtsstaaten» bezeichnete Justizministerin Eveline Widmer-Schlumpf im August 2009 den Vergleich, auf den sich die Schweiz und die USA damals geeinigt hatten.
Laut dem Vertrag muss die Grossbank UBS den US-Steuerbehörden 4450 Kontodaten von Kunden ausliefern, die der Steuerhinterziehung verdächtigt werden. Ursprünglich wollten die US-Behörden Informationen über 52’000 UBS-Kunden.
Die UBS-Verantwortlichen und der Bundesrat atmeten auf. Zu früh, wie sich im Januar 2010 herausstellte: Das Bundesverwaltungsgericht erklärte den Vertrag als letzte gerichtliche Instanz für ungültig.
Das Gericht berief sich bei seinem Entscheid auf das geltende Doppelbesteuerungs-Abkommen mit den USA. Demnach ist die Schweiz lediglich bei Steuerbetrug, nicht aber bei Steuerhinterziehung zur Amtshilfe verpflichtet. Die Kompetenz, Amtshilfe auch bei Steuerhinterziehung anzuwenden, habe allein das Parlament und nicht der Bundesrat, urteilte das Gericht.
Im Bestreben, der UBS weitere und schwerwiegende Probleme in den USA zu ersparen, suchte die Regierung nach einer Lösung. Sie wertete das Abkommen zu einem Staatsvertrag auf und beschloss, diesen dem Parlament zur nachträglichen Genehmigung vorzulegen.
Bankgeheimnis wird aufgehoben
In einer ersten Phase reagierten Politiker aller Couleur ablehnend. Als «erneute Beugung vor dem Rechtstaat» bezeichnete der Christdemokratische Nationalrat Pirmin Bischof das Vorhaben. Der Präsident der Freisinnigen, Fulvio Pelli, kritisierte, es sei die UBS gewesen, «die eine Katastrophe geschaffen hat», deshalb müsse sie als «Schuldige zur Verantwortung gezogen werden».
Der Chefstratege der rechtskonservativen Volkspartei (SVP), Christoph Blocher, bezeichnete den Vertrag «als Aushebelung des Bankgeheimnisses» und drohte mit einer «Volksabstimmung über das Bankgeheimnis».
Während Monaten lehnte die SVP den Vertrag kategorisch ab. Die Sozialdemokraten – zwar grundsätzlich gegen das Bankgeheimnis – witterten Morgenluft und machten ihr Ja zum Vertrag von flankierenden Massnahmen abhängig. Die bürgerlichen Mitteparteien einigten sich auf ein zähneknirschendes Ja und argumentierten, es stehe zu viel auf dem Spiel, falls die Schweiz die Grossmacht USA vor den Kopf stossen würde.
Radikale Kehrtwende der SVP
Da SVP und SP zusammen im Nationalrat eine Mehrheit haben, stieg die Nervosität im Bundesrat und bei den Banken. Der Bundesrat versuchte die SP zu besänftigen und legte am 28. April einen Planungsbeschluss vor. Darin versprach die Regierung, sie werde dem Parlament noch in diesem Jahr Vorlagen unterbreiten zur Bankenregulierung und zu einer Bonussteuer.
Die SP hielt ihre Drohkulisse aufrecht. Doch dann machte die SVP am 21. Mai eine radikale Kehrtwende. Begründung: Eine Bonussteuer sei eine zusätzliche Unternehmenssteuer und schade der Wirtschaft , zudem sei der Vertrag zwar «ein Übel», eine Ablehnung jedoch «noch das grössere Übel». Seither stehen die Chancen gut, dass das Parlament dem Amtshilfeabkommen mit den USA zustimmt.
Braucht es eine PUK?
Auch andere Rettungsmassnahmen zugunsten der UBS wurden von Bundesrat per Notrecht durchgesetzt. Die Linke und die SVP fordern deshalb seit Monaten eine Parlamentarische Untersuchungskommission (PUK). Sie soll Licht in die Rolle des Bundesrates und der Finanzmarktaufsicht in der UBS-Affäre bringen.
Die Mitteparteien finden eine PUK nur dann nötig, wenn eine Untersuchung der mit weniger Kompetenzen ausgestatteten Geschäftsprüfungskommission (GPK) noch Fragen offen lässt. Der Schlussbericht der GPK soll in den kommenden Tagen veröffentlicht werden.
Mittel gegen eine populäre Forderung
Weiter beschäftigen sich die Räte mit verschiedenen Volksinitiativen. So muss das Parlament entscheiden, ob es zur so genannten «Abzocker Initiative» gegen hohe Managerlöhne einen Gegenvorschlag ausarbeiten will.
Umfragen sagen der Initiative eine Volksmehrheit voraus. Bürgerliche Politiker versuchen deshalb, der Initiative mit einem Gegenvorschlag den Wind aus den Segeln zu nehmen.
Nicht mit dem Völkerrecht vereinbar
Wenn Ausländerinnen und Ausländer straffällig werden, können die Behörden laut geltendem Recht ihre Ausweisung anordnen. Die Ausschaffungsinitiative der SVP verlangt eine Verschärfung des geltenden Rechtes, indem sie aus der Möglichkeit der Wegweisung eine Pflicht machen will.
Laut Rechtsexperten verstösst die Initiative gegen das Völkerrecht , gegen die Europäische Menschenrechtskonvention und gegen das Personenfreizügigkeits-Abkommen mit der EU.
Der Ständerat hat sich deshalb in der Frühjahrssession für einen Gegenvorschlag ausgesprochen. Nun liegt der Ball beim Nationalrat. Dessen vorberatende Kommission ist den Linken und den Grünen – sie wehren sich gegen eine Verschärfung des geltenden Rechts – entgegen gekommen und hat den Gegenvorschlag mit einem Artikel ergänzt, der den Bund zu Integrationsmassnahmen verpflichtet.
Andreas Keiser, Bundeshaus, swissinfo.ch
Während der vom 31. Mai -18. Juni dauernden Sommer-Session befasst sich das Parlament auch mit einer Serie neuer Doppelbesteuerungs-Abkommen nach dem OECD 26-Standart. Laut diesen Abkommen wird die Schweiz künftig auch bei Steuerhinterziehung Amtshilfe gewähren.
Ein wichtiges Thema ist auch die Gesundheitspolitik. Nach langen Diskussionen in der vorberatenden Kommission beugt sich der Nationalrat über eine Vorlage zur Förderung von integrierten Versorgungsnetzen.
Krankenversicherer sollen gezwungen werden, solche Modelle anzubieten. Und für Patienten soll es finanzielle Anreize geben: Wer sich von Ärzten behandeln lässt, die nicht solchen Netzen angeschlossen sind, müsste demnach einen höheren Selbstbehalt in Kauf nehmen.
Bewegung kommt auch in die Debatte um die 11. AHV-Revision, die seit geraumer Zeit stagniert, weil die Linke die Erhöhung des Frauenrentenalters nur unter der Bedingung akzeptieren will, dass Frühpensionierungen abgefedert werden, während die Rechte weitgehend auf Abfederungen verzichten möchte.
Dem Ständerat liegt nun ein neues Modell vor, das auf Vorschlägen von Bundesrat Didier Burkhalter basiert und die Fronten aufweichen könnte. Profitieren würden Personen mit einem Jahreseinkommen bis 61’560 Franken. Ihre Einbussen beim Rentenvorbezug würden teilweise kompensiert.
Weiter geht es um Fragen, wie jener, ob jugendlichen Sans-Papiers eine Berufslehre ermöglicht werden soll, ob es ein Gesetz für Risikosportarten braucht und ob die Bücherpreise im Versandhandel reguliert werden können.
Das Parlament der schweizerischen Eidgenossenschaft besteht aus zwei Kammern, dem Nationalrat und dem Ständerat.
Der Nationalrat ist die Volksvertretung, der Ständerat die Vertretung der Kantone. Beide Kammern werden alle vier Jahre von den Schweizer Bürgerinnen und Bürgern gewählt.
Der Nationalrat zählt 200 Mitglieder. Entsprechend der Bevölkerungsgrösse haben die Kantone Anrecht auf eine bestimmte Anzahl Sitze.
Im Ständerat sitzen 46 Abgeordnete. Jeder Kanton stellt zwei Räte, die sechs Halbkantone je einen.

In Übereinstimmung mit den JTI-Standards

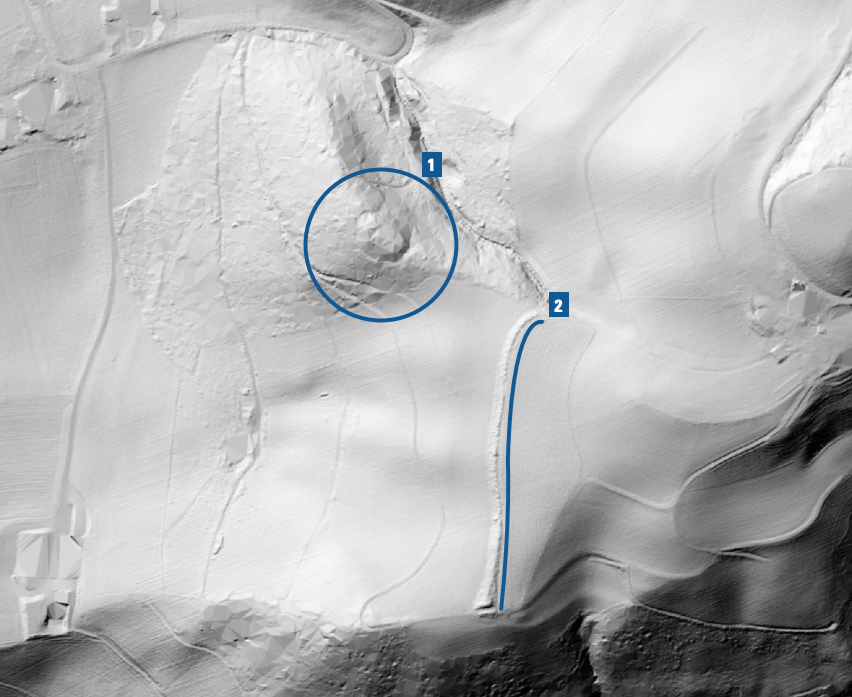











Einen Überblick über die laufenden Debatten mit unseren Journalisten finden Sie hier. Machen Sie mit!
Wenn Sie eine Debatte über ein in diesem Artikel angesprochenes Thema beginnen oder sachliche Fehler melden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an german@swissinfo.ch