Pharmaunternehmen entwickeln endlich Medikamente für Frauen

Medikamente können bei Frauen anders wirken als bei Männern. Doch bei der Entwicklung von Arzneimitteln werden Geschlecht und Gender nur selten berücksichtigt. Nun wird auch in der Schweiz ein Umdenken gefordert.
Nach mehr als 20 Jahren hat die US-Arzneimittelbehörde FDA im Juli 2023 erstmals wieder ein Alzheimer-Medikament zugelassen. Lecunemab, das unter dem Markennamen Leqembi von der US-Firma Biogen vertrieben und von der japanischen Firma Eisai entwickelt wird, reduziert die Amyloid-Ablagerungen, die sich im Gehirn bilden. Diese sind charakteristisch für die Krankheit, die weltweit etwa 55 Millionen Menschen das Gedächtnis raubt.
Laut der StudieExterner Link, die für die Zulassung ausschlaggebend war, verlangsamt das Medikament den kognitiven Verfall im Vergleich zu einem Placebo um 27 Prozent.
Der ergänzende Anhang zeigt jedoch ein komplexeres Bild. Unter den 1700 Patient:innen der Studie, von denen 51,7 Prozent Frauen waren, gab es grosse geschlechtsspezifische Unterschiede. Das Medikament verlangsamte den kognitiven Abbau bei Frauen nur um 12%, bei Männern dagegen um 43%.
Die Resultate seien schwierig zu interpretieren, da die Studie nicht darauf ausgelegt war, Unterschiede in der Wirkung des Medikaments bei Frauen und Männern festzustellen, erklärt ein Sprecher von Eisai gegenüber SWI swissinfo.ch. Dazu müssten unter anderem die Stichprobengrösse und der Krankheitsverlauf im Vergleich zur Placebo-Gruppe genauer untersucht werden. Dennoch werfen die Ergebnisse unter Expert:innen Fragen auf, insbesondere angesichts der Tatsache, dass zwei Drittel der Alzheimer-Patient:innen Frauen sind.
«Leqembi ist ein Durchbruch für Alzheimer-Patienten», sagt die Neurowissenschaftlerin Antonella Santuccione Chadha, die zwei Jahre lang im Alzheimer-Programm von Biogen gearbeitet hat und jetzt Mitbegründerin der Women’s Brain Foundation in Zürich ist. «Aber wir müssen anerkennen, dass das Medikament bei Männern und Frauen unterschiedlich wirkt, und verstehen, warum das so ist.»

Mehr
Die Top-Geschichten der Woche abonnieren
Diese Frage stellen sich zunehmend auch Arzneimittelbehörden und grosse Geldgeber im Gesundheitswesen. Im vergangenen Jahr kündigte der Schweizerische Nationalfonds (SNF), der grösste öffentliche Geldgeber für biomedizinische Forschung in der Schweiz, ein mit 11 Millionen Schweizer Franken (13 Millionen US-Dollar) dotiertes Programm an, um Wege zu finden, Geschlecht (biologische Merkmale) und Gender (Identität) in die Gesundheitsforschung und Medizin zu integrieren.
Dieser Schritt spiegelt eine Entwicklung wider, die auch in anderen Ländern wie den USA, Kanada und Europa zu beobachten ist. Ziel ist es, den männlich dominierten Ansatz in der medizinischen Forschung in Frage zu stellen und Medikamente zu entwickeln, die auf die Bedürfnisse von Frauen zugeschnitten sind.
«Bikini-Medizin»
Die Tatsache, dass mehr als die Hälfte der Teilnehmer:innen der Leqembi-Studie Frauen waren und dass die Studie überhaupt nach Geschlecht aufgeschlüsselte Daten enthält, sei ein Zeichen des Fortschritts, so die von SWI befragten Expert:innen.
Obwohl 70 Prozent der Patient:innen mit chronischen Schmerzen Frauen sind,Externer Link werden 80 Prozent der SchmerzstudienExterner Link nur an Männern oder männlichen Mäusen durchgeführt. Männer dominieren nach wie vor viele klinische Studien zu Krankheiten, von denen Frauen überproportional betroffen sind.
Multiple Sklerose, eine chronische Erkrankung des Nervensystems, tritt bei Frauen doppelt so häufig auf. Frauen sind auch anfälliger für Schlaganfälle, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Autoimmunerkrankungen wie Lupus.
Studienergebnisse werden selten nach Geschlecht und Gender aufgeschlüsselt und veröffentlicht. Und selbst wenn dies der Fall ist, werden Unterschiede in der Wirksamkeit und Sicherheit für Männer und Frauen bei der Zulassung und Verschreibung von Medikamenten nur selten berücksichtigt.
Wenn Frauen tatsächlich im Fokus der medizinischen Forschung stehen, dann häufig bei Krankheiten, die ihre Geschlechtsorgane betreffen.
«Die Gesundheit von Frauen ist mehr als nur diese Idee der Bikini-Medizin», sagt Stephanie Sassman, Leiterin Frauengesundheit bei Genentech, einer Tochterfirma des Schweizer Pharmakonzerns Roche.
Die mangelnde Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Unterschiede in der Arzneimittelforschung hat gravierende Folgen für die Gesundheit von Frauen. «Es gibt Hunderte von Krankheiten, bei denen Frauen eine verspätete Diagnose erhalten, völlig falsch diagnostiziert werden oder eine Behandlung oder Dosierung erhalten, die unwirksam oder sogar unsicher ist», fügt Sassman hinzu.
Laut einer im Januar veröffentlichten StudieExterner Link des McKinsey Health Institute wurden in den letzten 40 Jahren 3,5-mal mehr Medikamente wegen Nebenwirkungen bei Frauen vom Markt genommen als bei Männern.
Sogar in der Schweiz, die über eines der besten Gesundheitssysteme der Welt verfügt, zeigt ein im Mai veröffentlichter BerichtExterner Link im Auftrag der Regierung, dass Frauen weniger gut angepasste Behandlungen erhalten, was zu «mehr Nebenwirkungen und einer schlechteren Prognose» führt.
Vorurteile vom Anfang an
Einer der Hauptgründe dafür, dass diese Lücke in der Frauengesundheit fortbesteht, ist, dass Vorurteile bereits in den wissenschaftlichen Modellen der frühen Forschung verankert sind und sich auf spätere Phasen der Arzneimittelentwicklung übertragen.
Bis vor kurzem betrachteten Forscher den weiblichen Körper als eine kleinere Version des männlichen Gegenstücks. Laut einer Studie des Economist, die 2023 von der Women’s Brain FoundationExterner Link in Auftrag gegeben wurde, gibt es immer noch 5,5-mal mehr Studien, die nur männliche Tiere verwenden, als Studien, die weibliche Tiere einbeziehen.
«Einige Forscher sind so sehr daran gewöhnt, männliche Tiere zu verwenden, dass sie sich nicht einmal die Frage stellen, ob es anders wäre, wenn man die Gehirnmechanismen von weiblichen und männlichen Mäusen untersuchen würde», sagt Carole Clair, Leiterin der Abteilung für Gesundheit und Gender am Universitätszentrum für Allgemeinmedizin und öffentliche Gesundheit (Unisanté) in Lausanne.

Mehr
Unterschiede zwischen Frauen und Männern gibt es auch bei der Gesundheit
Selbst wenn sich Forscher:innen und Pharmaunternehmen dieser Unterschiede bewusst sind, argumentieren sie oft, dass die Einbeziehung von Frauen kompliziert und kostspielig sei, insbesondere angesichts der schwankenden Hormonspiegel von Frauen während des Menstruationszyklus. StudienExterner Link zeigen jedoch, dass auch die Hormonschwankungen bei Männern ein Faktor für die Reaktion auf Medikamente sind.
Langsamer Wandel
Die Regierungen sind sich der geschlechtsspezifischen Unterschiede zunehmend bewusst, tun sich aber schwer damit, einen Weg zu finden, diese Unterschiede zu beseitigen und gleichzeitig die Sicherheit zu gewährleisten, die Kosten unter Kontrolle zu halten und die Forschung nicht zu sehr einzuschränken.
1993 gab die FDA eine Richtlinie heraus, in der klargestellt wurde, dass Frauen in allen Phasen der klinischen Arzneimittelentwicklung einbezogen werden solltenExterner Link.
Im selben Jahr forderten die National Institutes of Health (NIH) in den USA, der grösste öffentliche Geldgeber für biomedizinische Forschung, die Einbeziehung von Frauen in öffentlich finanzierte klinische Studien der Phase III, in denen Medikamente an grossen Bevölkerungsgruppen getestet werden.
Die Europäische Union folgte diesem Beispiel und entwickelte 2014 ein InstrumentariumExterner Link zur Berücksichtigung der Geschlechtergleichstellung in der EU-finanzierten Forschung.
«Nur weil es eine Richtlinie gibt, heisst das nicht, dass sie auch befolgt wird», sagt Santuccione Chadha. Verschiedene Studien zeigen, dassExterner Link die Anzahl und der Anteil von Frauen in klinischen Studien insgesamt zugenommen haben, aber in der frühen Forschung mit Tieren gibt es weniger Fortschritte. Es gibt auch kaum Bemühungen, die Ergebnisse geschlechtsspezifisch zu analysieren und für die Entwicklung von Medikamenten für Frauen zu nutzen.
Viele der Richtlinien sind vage formuliert und werden nicht konsequent umgesetzt. Eine Analyse von 107 NIH-finanzierten Studien aus dem Jahr 2018 zeigt, dass die EinschlussquoteExterner Link von Frauen zwar im Durchschnitt bei 46 Prozent lag, aber rund 15 Prozent der Studien weniger als 30 Prozent Frauen einschlossen und nur 26 Prozent überhaupt über geschlechtsspezifische Ergebnisse berichteten.
In der Schweiz hingegen wurden geschlechtsspezifische Anforderungen an klinische Studien langsamer umgesetzt. Der Schweizerische Nationalfonds, mit einem Jahresbudget von rund einer Milliarde Schweizer Franken der grösste biomedizinische Förderer in der Schweiz ist, hat keine Vorgaben zur Geschlechterdiversität.
«In der Schweiz sind Geldgeber vorsichtig, wenn es darum geht, der Forschung zu viele Vorgaben zu machen. Sie sind der Ansicht, dass dies in der individuellen Verantwortung der Forschenden liegt», sagt Clair. «Es sollte eigentlich selbstverständlich sein, dass man die zu behandelnde Bevölkerungsgruppe in seine Studie einbezieht, aber wenn man keinen Top-down-Ansatz hat, um dies durchzusetzen, wird es vielleicht nicht passieren.»
Inzwischen zeichnet sich eine grössere Dynamik ab, die zum Teil durch die Covid-19-Pandemie beflügelt wurde, bei der sich zeigte, dass Frauen stärker unter denExterner Link Impfnebenwirkungen litten als Männer. Die Schweiz hat ihr Gesetz über klinische Versuche revidiert, das im November in Kraft trittExterner Link und ein ausgewogeneres Geschlechterverhältnis in der Forschung vorschreibt.
Die Schweizer Regierung hat zudem Swissmedic beauftragt, Wege zu finden, um Geschlecht und Gender besser in die Bewertung neuer Medikamente einzubeziehen – Änderungen werden bis 2029 erwartet. Auch das Programm des Schweizerischen Nationalfonds soll Wege aufzeigen, wie die Geschlechterkluft in der frühen Forschung geschlossen werden kann.
Boomender Markt
Auch Pharmaunternehmen zeigen sich aufgeschlossener, denn sie sehen einen boomenden Markt für «Femtech» – Produkte für Frauen. Marktforschungsdaten deuten darauf hin,Externer Link dass allein der Markt für Produkte für die Wechseljahre bis 2031 ein Volumen von 24 Milliarden US-Dollar erreichen könnte.
«Wenn man den gesamten Patient Journey aus der Perspektive einer Frau betrachtet, eröffnen sich neue Möglichkeiten», sagt Sassman. Roche hat 2022 das ProjektX ins Leben gerufen, um Investitionen in die Frauengesundheit voranzutreiben. Dabei wird die Diversität in klinischen Studien untersucht, aber auch Faktoren wie Fruchtbarkeit und Wechseljahre werden berücksichtigt, um den Verlauf von Krankheiten und das Ansprechen auf Behandlungen zu verstehen.
Das seien Schritte in die richtige Richtung, sagt Santuccione Chadha, aber das Geschlecht werde bei der Arzneimittelentwicklung immer noch vernachlässigt.
«Wir müssen wirklich umdenken, damit Geschlechts- und Genderunterschiede von Anfang an erkannt und diskutiert werden», sagt Santuccione Chadha. «Dadurch werden Medikamente für alle sicherer und wirksamer.»
Grafik von Pauline Turuban, editiert von Virginie Mangin/ts. Übertragung aus dem Französischen: Michael Heger

In Übereinstimmung mit den JTI-Standards









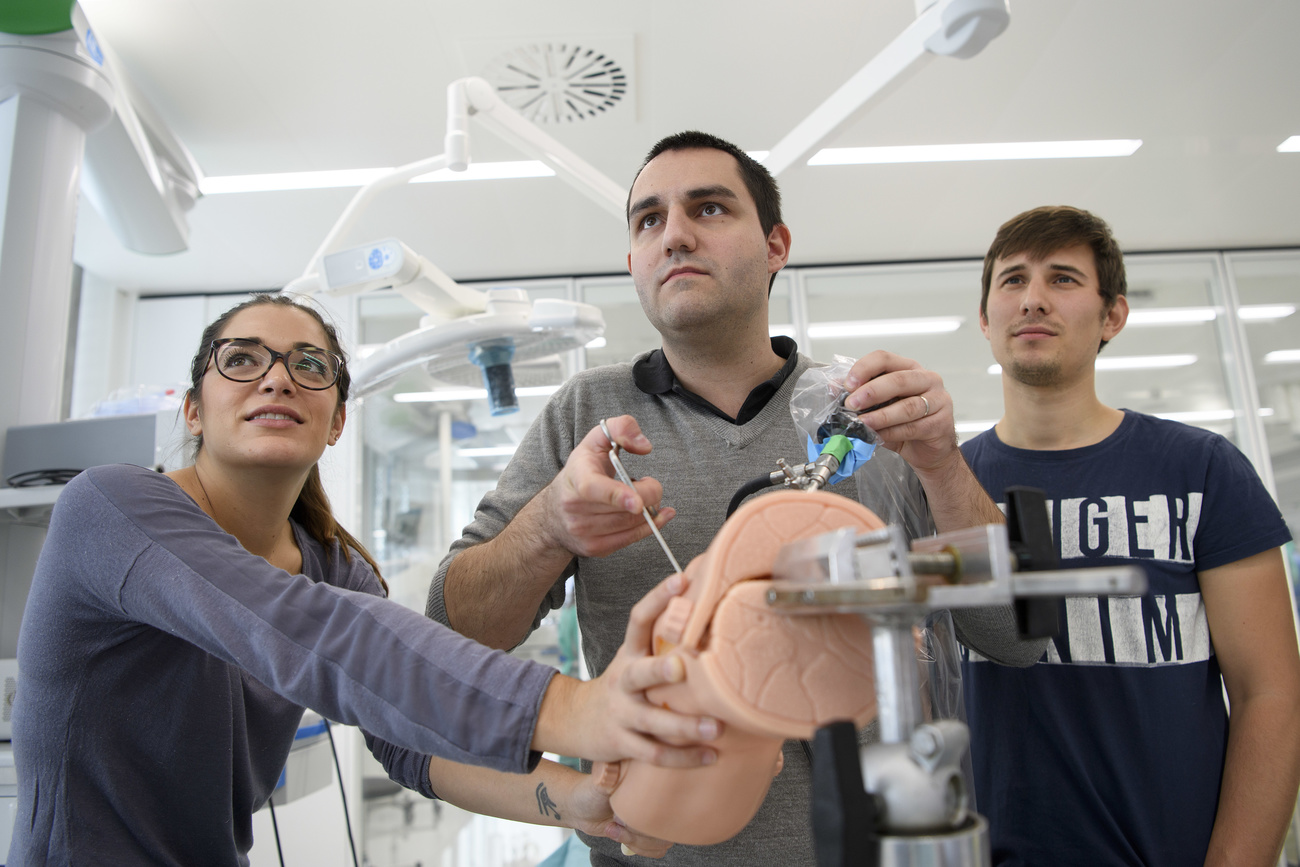



Einen Überblick über die laufenden Debatten mit unseren Journalisten finden Sie hier. Machen Sie mit!
Wenn Sie eine Debatte über ein in diesem Artikel angesprochenes Thema beginnen oder sachliche Fehler melden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an german@swissinfo.ch