Grossbank-Engagement stellt Unabhängigkeit in Frage

Ein Sponsoring-Abkommen zwischen der Universität Zürich und der Grossbank UBS hat die private Unterstützung von staatlichen Hochschulen ins Scheinwerferlicht gerückt. Sponsoring sei zentral, um in der weltweiten Konkurrenz bestehen zu können, sagen die einen. Kritiker warnen, die akademische Unabhängigkeit gerate in Gefahr.
Ursula Jauch ist kategorisch: «Es ist ein faustischer Pakt. Die UBS hatte während Jahren ein grosses Imageproblem, und sie will ihren Namen mit ausgefeiltem Marketing wieder reinwaschen», sagt die Professorin für Philosophie an der Universität Zürich (UZH).
Im April 2012 haben die UZH und die Schweizer Grossbank viele überrascht, als sie ein Sponsoring im Umfang von 100 Millionen Franken bekanntgaben. Mit diesem werden am Institut für Volkswirtschaftslehre fünf Lehrstühle und ein «UBS International Center of Economics in Society» geschaffen.
Privat-öffentliche Partnerschaften sind für Schweizer Universitäten nicht neu, doch weil er im Geheimen gestrickt wurde, hat dieser Kooperationsvertrag einige Alarmlichter aufleuchten lassen.
Aufgeschreckt durch den Deal, hat Jauch zusammen mit 26 anderen führenden Schweizer Professorinnen und Professoren im Februar den «Zürcher Appell» lanciert. Dieser ruft international dazu auf, die akademische Freiheit zu schützen. «Sind die heutigen Universitäten im Zeitalter von Kooperationen und Sponsoring noch hinreichend unabhängig?», fragt die Online-Petition. Bis heute haben über 1550 Personen unterschrieben.
Veröffentlichung nach Druck
Nach monatelangem Widerstand hat sich die UZH nach einem Entscheid der Rekurskommission der Zürcher Hochschulen im November schliesslich bereiterklärt, 90 Prozent des bis dahin geheimen Abkommens mit der UBS bekanntzugeben. Dies, nachdem zwei Journalisten auf eine Veröffentlichung gedrängt hatten.
Kritiker erklärten, die Universität habe das Dokument nicht publizieren wollen, weil es ganz klar zeige, wie stark die Grossbank in der UZH involviert sei und welche spezifischen «Rechte» sie sich ausbedungen habe. Doch die Vertreter des UBS-Centers an der Universität spielten die Angelegenheit und eine mögliche Einflussnahme auf die Forschung herunter.
«Das Departement wird ein Mitglied des Verwaltungsrats der UBS für den Beirat des (Wirtschafts-)Departements nominieren.»
«Ein Hörsaal des Departements wird nach dem ‹UBS International Center of Economics in Society› benannt.» (am 19.12.2013 verzichteten die Vertragspartner darauf)
«Die UBS soll von den Aktivitäten des UBS-Centers angemessen profitieren:
– UBS-Personal und ausgewählte Kunden sollen privilegierten Zugang zu Kursen erhalten.
– Es soll ein regelmässiger Austausch zwischen Mitgliedern des UBS-Centers, der Lehrstühle und UBS-Spezialisten organisiert und unterstützt werden.
– Zwischen den Lehrstühlen und der UBS sollen Interaktions-Kanäle zur Verfügung gestellt und organisiert werden.
– Von den Inhabern der Lehrstühle wird die Teilnahme am jährlichen ‹UBS International Economic Forum› erwartet.»
«Während der gesamten Dauer des Sponsorings des UBS-Centers durch die UBS Foundation dürfen die UZH und das Departement im Wirtschaftsbereich keine Sponsoring-Abkommen eines Instituts, eines Forschungszentrums oder einer Zusammenarbeit eingehen.»
«Die Vertragsparteien sollen alles daran setzen, dass dieses Abkommen und sein Inhalt streng geheim bleiben.»
Doch das Thema war damit noch nicht gegessen: Anfang Dezember demonstrierten Studierende der UZH gegen den «Ausverkauf der Bildung» und verlangten, dass der Deal aufgehoben werde.
Am 19. Dezember schliesslich teilte die Universität Zürich mit, der Sponsoring-Vertrag zwischen der UZH und der UBS werde nun aufgrund des «öffentlichen Interesses nach Transparenz» vollständig offengelegt. «Die nun zusätzlich offen gelegten Vertragsteile belegen, dass die Unabhängigkeit von Forschung und Lehre vollständig gewährleistet ist», heisst es in der Mitteilung.
Die Finanzierung
Trotzdem hat die Kontroverse an den 12 öffentlichen Schweizer Universitäten eine grössere Debatte um Sponsoring, private Unterstützung, Einfluss und Transparenz angestossen.
Zwischen 1995 und 2010 stiegen die jährlichen Zuwendungen von privaten Spendern an staatliche Universitäten von 470 Millionen auf rund 1 Milliarde Franken, was wegen der steigenden Kosten über die Jahre immer etwa 14% aller Gelder ausmachte, welche die Universitäten erhielten. Je nach Institution schwankte der Anteil zwischen 7 und 40%.
Marcel Hänggi – einer der Journalisten, welche die UZH zur Veröffentlichung des Abkommens gezwungen haben – ist allerdings der Meinung, dass diese Zahlen nicht die wahre Geschichte erzählen.
Was sich verändert habe, seien die weltweite Konkurrenz und neue Gesetze während der letzten 15 Jahre, die eine leichte Kursänderung in Richtung eines eher unternehmerischen Ansatzes provoziert hätten.
«Die Universitäten haben angefangen, sich wie Firmen zu benehmen», betont er. «Sie führen Experimente mit sich selber durch, finanzieren aber keine Forschung über die Konsequenzen ihres Handelns.»
Breite Debatte
In einer Rede vor der Volkswirtschaftlichen Gesellschaft unterstrich Lino Guzzella, Rektor und designierter Präsident der anderen Zürcher Universität, der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich (ETH), die Bedeutung von privaten Geldgebern.
«Die enge Verbindung von Wirtschaft und Wissenschaft ist ein entscheidender Faktor für das Erfolgsmodell Schweiz», sagte er. Die ETH nehme aber «nicht jedes Geld», betonte er und ergänzte, Auftragsforschung sei eine Ausnahme und das wichtigste Gut einer wissenschaftlichen Institution seien «Vertrauen und Unabhängigkeit».
Die ETH in Lausanne (EPFL) hat 31 geförderte Lehrstühle im Umfang von 11,1 Millionen Franken. Davon sind 14 mit privaten Unternehmen wie Nestlé und Merck Serono verbunden. EPFL-Sprecher Jérome Gross spielt deren Bedeutung wie auch das wirtschaftsfreundliche Image der Institution herunter: Diese Lehrstühle machten nur 1,4% des jährlichen Aufwands aus, sagt er.
Er gibt aber auch zu, dass Geld von privaten Firmen eine «echte Finanzierungsquelle sind, die Schweizer Universitäten erlaubt, sich zu entwickeln – im Wissen darum, dass die öffentlichen Mittel nicht genügend erhöht werden».
Nicht verhandelbar
Im Vergleich mit anderen europäischen Universitäten schneiden die Schweizer Institute in Ranglisten sehr gut ab. Was die Offenheit gegenüber Wirtschaft und Wettbewerb betrifft, ist der schweizerische akademische Markt der «am meisten amerikanisierte».
Für Antonio Loprieno, Präsident der Rektorenkonferenz der Schweizer Universitäten (CRUS) und Rektor der Universität Basel, sollte die private Einmischung bei Schweizer Universitäten grundsätzlich nicht hinterfragt werden, sonst könnte dies deren Fähigkeit schmälern, im globalen Wettbewerb zu bestehen.
«Wegen der möglichen Bedrohung von Investitionen in Schweizer Universitäten oder der Einschränkung der Konkurrenzfähigkeit zwischen Universitäten, ist die CRUS der Meinung, dass wir uns in einer Übergangsphase befinden», so Loprieno. «Wir sollten potenzielle Spender nicht abschrecken und mehr institutionelle Erfahrung sammeln, bevor wir Schlussfolgerungen ziehen.»
Kürzlich verlangte der schweizerische Wissenschafts- und Technologierat von der Rektorenkonferenz klare Leitlinien für die Beziehungen zwischen Universitäten, Lehrstühlen und privaten Partnern, sowie mehr Transparenz bei den Verträgen. Die CRUS wies diesen Aufruf zurück, unterstützt von Bundesrat Johann Schneider-Ammann, Vorsteher des Eidgenössischen Departements für Wirtschaft, Bildung und Forschung.
Geheime Abkommen
Loprieno ist auch der Meinung, öffentliche Universitäten hätten ein Recht, Verträge mit privaten Sponsoren geheimzuhalten. Dies wird je nach Hochschule sehr unterschiedlich gehandhabt. «Eine Universität ist primär eine öffentliche, aber zunehmend auch eine kompetitive Institution auf globalem Niveau. Daher braucht ein Minimum an Wettbewerbsfähigkeit manchmal mehr Flexibilität, was die Transparenz angeht», erklärt er.
Ein aktueller Sponsoring-Fall zur Schaffung eines Lehrstuhls für Gesundheitsökonomie zwischen seiner Universität und Interpharma, dem Verband der forschenden pharmazeutischen Firmen, belegt, wie ein unterschiedlicher Ansatz Verwirrung stiften kann. Anders als die Universität wollte Interpharma angeblich die Details des Vertrags veröffentlichen. Frustriert über die undurchsichtige Praxis des Instituts liess der Verband durchsickern, dass der Vertrag 500’000 Franken pro Jahr umfasst.
An der Universität Zürich scheint sich die Stimmung aber verändert zu haben. Der temporäre Rektor der UZH, Otfried Jarren, erklärte gegenüber der Zeitung Schweiz am Sonntag am 8. Dezember: «Für mich ist Sponsoring an Universitäten ein Grenzfall. Denn es geht um Leistung und Gegenleistung: Sichtbarkeit und Markenpräsenz. Das ist nicht immer einfach.» Im gleichen Interview sagte er auch: «Ein Sponsoring wie bei der UBS wird es in dieser Form nicht mehr geben.»

In Übereinstimmung mit den JTI-Standards











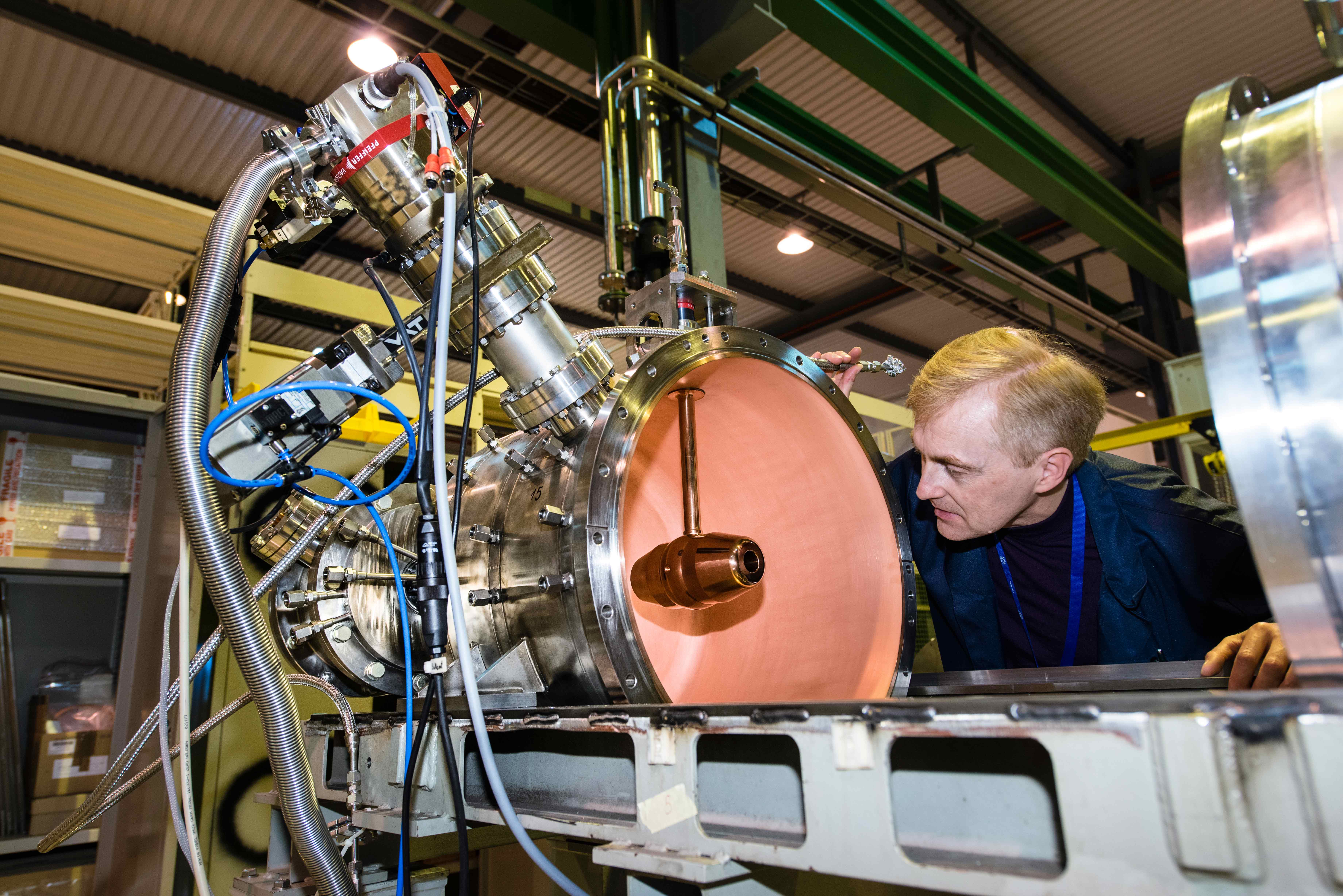
Einen Überblick über die laufenden Debatten mit unseren Journalisten finden Sie hier. Machen Sie mit!
Wenn Sie eine Debatte über ein in diesem Artikel angesprochenes Thema beginnen oder sachliche Fehler melden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an german@swissinfo.ch