Der Schweizer Sirenentest: Wenn die Unwissenden aufgeschreckt werden

Am ersten Mittwoch im Februar heulen jedes Jahr in der ganzen Schweiz 7200 Sirenen und erschrecken alle, die nicht wissen, dass es sich um einen Testlauf handelt. Aber wüssten Sie, was zu tun wäre, wenn es sich um einen echten Alarm handeln würde?
Als ich die Sirenen zum ersten Mal hörte, war ich verwirrt und etwas beunruhigt. Ich schaute mich ruhig im Büro um, und erst als ich einen Kollegen sah, der auf seine Uhr schaute und nickte, begriff ich langsam, was los war.
Leider hatte ich die Hinweise in den Medien verpasst, dass um 13.30 Uhr alle Sirenen in der Schweiz heulen würden. Zwanzig Jahre später empfinde ich die ersten Sekunden immer noch als beunruhigend.
«Es sind keine Verhaltens- und Schutzmassnahmen zu ergreifen. Die Bevölkerung wird um Verständnis für die mit der Sirenenkontrolle verbundenen Unannehmlichkeiten gebeten», schreibt das Bundesamt für BevölkerungsschutzExterner Link (BABS) in charmant schweizerischer Höflichkeit.
Hier ein populärer Werbespot des BABS, der auf den Sirenentest aufmerksam macht – mit Anspielung auf den Videokunst-Klassiker «Der Lauf der Dinge»Externer Link der Schweizer Künstler Peter Fischli und David Weiss:
Fast alle Länder der Welt warnen ihre Bevölkerung mit stationären Sirenen vor einer drohenden Gefahr, sei es eine Invasion, ein Raketenangriff, ein Atomunfall oder eine Naturkatastrophe wie Tsunami, Vulkanausbruch, Tornado, Erdbeben.
Die Schweiz verfügt mit 5000 stationären und 2200 mobilen Sirenen über eines der dichtesten nationalen Zivilschutz-Sirenennetze der Welt.
Seit der Mensch schreien, trommeln, hupen oder klingeln kann, warnt er seine Nachbarn vor Gefahren. Der französische Physiker Charles Cagniard de la Tour (1777-1859) gilt als Erfinder der modernen Sirene im Jahr 1819. Doch wie kam es dazu, dass in der Schweiz Tausende von Sirenen aufgestellt wurden?
«Recherchen in schweizerischen Zeitungs- und Zeitschriftendatenbanken lassen vermuten, dass Sirenen in der Schweiz ab dem Ersten Weltkrieg vereinzelt für Feueralarme eingesetzt wurden», schreibt der Kurator und Historiker Juri Jaquemet in einem Blogbeitrag für das Schweizerische NationalmuseumExterner Link.
«Das Oberländer Tagblatt meldet am 10. April 1920 einen ersten Versuch der Feuerwehr in Thun. Die auf einem der Türme des Schlosses installierte Sirene vermochte aber noch nicht zu überzeugen. Der Alarm dieser Motorsirene sei nicht stark genug, um die Leute aus dem Schlaf zu wecken, oder während des Tageslärms wirksam und genügend durchdringen zu können.»
Der Zweite Weltkrieg und die damit verbundene Bedrohung aus der Luft veranlasste die Schweizer Regierung, die «luftschutzpflichtigen Gemeinden» anzuweisen, «Luftschutzwarnungen durchzuführen und feste und bewegliche Sirenen aufzustellen».
«Die Firma Gfeller AG aus Bern bot wohl noch während des Krieges erste technische Lösungen an, um mehrere Sirenen gleichzeitig via Telefonleitung anzusteuern und auszulösen», schreibt Jaquemet weiter.
Während der Kalte Krieg zu einem Boom im Bunkerbau führte, wurde der Alarmierung – mit Ausnahme des Wasseralarms – weniger Beachtung geschenkt. Nach der Staudammkatastrophe von Vajont in Italien 1963Externer Link, bei der rund 2000 Menschen ums Leben kamen, befürchteten die Behörden, dass etwas Ähnliches auch in der Schweiz passieren könnte. Ab 1971 mussten die Gebiete im Umkreis von zwei Stunden um eine mögliche Überschwemmung durch eine Stauanlage mit einem Sirenensystem ausgerüstet werden.
Ab den 1980er-Jahren bemühten sich die Zivilschutzbehörden um ein dichteres Alarmierungsnetz und standardisierte Probealarme in der ganzen Schweiz. Am Mittwoch, 1. September 1982, heulten um 13:30 Uhr erstmals in der ganzen Schweiz gleichzeitig die Sirenen. «Das Resultat der Übung überzeugte nicht», schreibt Jaquemet.
«In den Kantonen Jura, Wallis, Waadt, Obwalden und Graubünden waren die Alarmsysteme nicht betriebsbereit aufgebaut und die Heuleinrichtungen blieben stumm.»
1988 machte die Landesregierung den Sirenentest zur Pflicht. Von 1981 bis 1990 wurde zweimal jährlich, jeweils am ersten Mittwoch im Februar und im September, ein Sirenentest durchgeführt. Danach wurde der Sirenentest aufgrund einer parlamentarischen Initiative – wegen des guten Zustands der Sirenen – auf einen einmaligen Alarm pro Jahr reduziert.
(Quelle: Sirenenalarm, Druckluft und sich sträubende HaareExterner Link, Blog des Schweizerischen Nationalmuseums)
Die Schweiz – oder Teile des Landes – könnten jederzeit von natürlichen, technischen oder gesellschaftlichen Katastrophen und Notlagen betroffen sein, warnt das BABS. Bestehe eine unmittelbare Gefahr für die Bevölkerung, werde eine Sirene ausgelöst.
In der Schweiz gibt es zwei Sirenenarten: den Allgemeinen Alarm für eine generelle Gefährdung der Bevölkerung sowie den Wasseralarm für Personen, die in möglichen Überschwemmungsgebieten unterhalb von Stauseen wohnen.
Seit 2018 werden Warnungen auch über die Website Alertswiss an Smartphones gesendetExterner Link, die ebenfalls Notfallinformationen enthalten.
Die Alertswiss-AppExterner Link informiert über Naturkatastrophen wie Überschwemmungen oder Waldbrände und warnt vor Gefahren wie Chemie- oder Atomunfällen und möglichen Terroranschlägen. Sie ist kostenlos für iOSExterner Link und AndroidExterner Link erhältlich.
Am ersten Mittwoch im Februar um Punkt 13:30 Uhr wird landesweit der allgemeine Alarm getestet.
Dabei handelt es sich um einen gleichmässigen auf- und absteigenden Ton von einer Minute Dauer, der nach einer zweiminütigen Pause einmal wiederholt wird. Bei Bedarf können die allgemeinen Sirenen an diesem Tag bis 14:00 Uhr weiter getestet werden.
«Allgemeiner Alarm MP3». Released: 2002.
Ab 14:00 bis spätestens 16:30 Uhr wird der Wasseralarm im gefährdeten Gebiet unterhalb von Stauanlagen getestet.
Er besteht aus 12 tiefen Dauertönen, die 20 Sekunden dauern und in Abständen von zehn Sekunden wiederholt werden.
«Wasser MP3». Released: 2002.
In den meisten Jahren funktionieren 99% der Sirenen – laut BABS innerhalb der normalen Fehlertoleranz.
Das Schweizer Netz ist einzigartig, weil es sowohl städtische als auch ländliche Gebiete abdeckt. «Wir haben zum Beispiel nicht nur fest installierte, sondern auch mobile Sirenen, die auf Autos montiert sind und im Alarmfall eine bestimmte Strecke in einem abgelegenen Gebiet abfahren, um die Bevölkerung zu informieren», sagte Dennis Rhiel, damaliger Informationschef des BABS, 2010 gegenüber SWI swissinfo.ch.
«Unsere Nachbarländer haben ebenfalls viele Sirenen installiert, aber kein Land hat ein so flächendeckendes System wie die Schweiz», sagte er.

Wie der Ernstfall aussieht
Was aber ist zu tun, wenn die Sirenen heulen und es nicht 13:30 Uhr am ersten Mittwoch im Februar ist?
Wenn es sich um den allgemeinen Alarm handelt, «informieren Sie sich über die App oder die Website von Alertswiss und hören Sie Radio», rät ch.ch, das Informationsportal des BundesExterner Link.
«Die SRG-Sender und viele Privatradios verbreiten im Katastrophenfall die Verhaltensanweisungen der Behörden. Folgen Sie den Anweisungen», heisst es weiter.
Bei Wasseralarm muss das das gefährdete Gebiet sofort verlassen werden. «Beachten Sie örtliche Merkblätter, Anweisungen der Behörden und informieren Sie sich über die App Alertswiss», so ch.ch.
In der Praxis kam der Wasseralarm unter anderem 2007 in Bern zum Einsatz, als die Aare einen gefährlichen Pegelstand erreichte. Der Alarm wurde ausgelöst, um die Bevölkerung zu warnen, ihr Hab und Gut zu schützen und sich vom Fluss fernzuhalten.
2008 heulten in der Kleinstadt Adliswil südlich von Zürich die Sirenen. Die Einwohnerinnen und Einwohner, die ihre Radios einschalteten, erfuhren, dass ihr Wasser verschmutzt war und vor dem Trinken abgekocht werden sollte.
Das BABS räumt ein, dass es Personen gibt, die nicht direkt gewarnt werden können, darunter etwa Gehörlose. Es gibt auch Menschen, die zwar die Sirenen hören, aber die nötigen Informationen nicht verstehen können, weil sie die Sprache nicht sprechen.
Deshalb sei es wichtig, dass sich Nachbarn gegenseitig informieren, heisst es. Die Behörden empfehlen auch, ein tragbares Radiogerät und genügend Ersatzbatterien zu Hause aufzubewahren.
Sehen Sie sich hier die diesjährige Sirenenerinnerung an:
Ist das Sirenensystem veraltet?
Sind Sirenen angesichts der technischen Entwicklung veraltet? Vorerst nicht. Im November kündigte die Regierung an, das Katastrophenwarnsystem durch Warnungen über das Mobilfunknetz und andere digitale Kanäle zu modernisieren.
Mit Hilfe der «Cell-Broadcast»-Technologie können beispielsweise rund 500 Zeichen lange Nachrichten an alle Handys im Empfangsbereich einer Antenne gesendet werden. Das herkömmliche System der Warnsirenen bleibe aber erhalten, hiess es.
Editiert von Samuel Jaberg / dos, Übertragung aus dem Englischen: Christian Raaflaub
Mehr

In Übereinstimmung mit den JTI-Standards





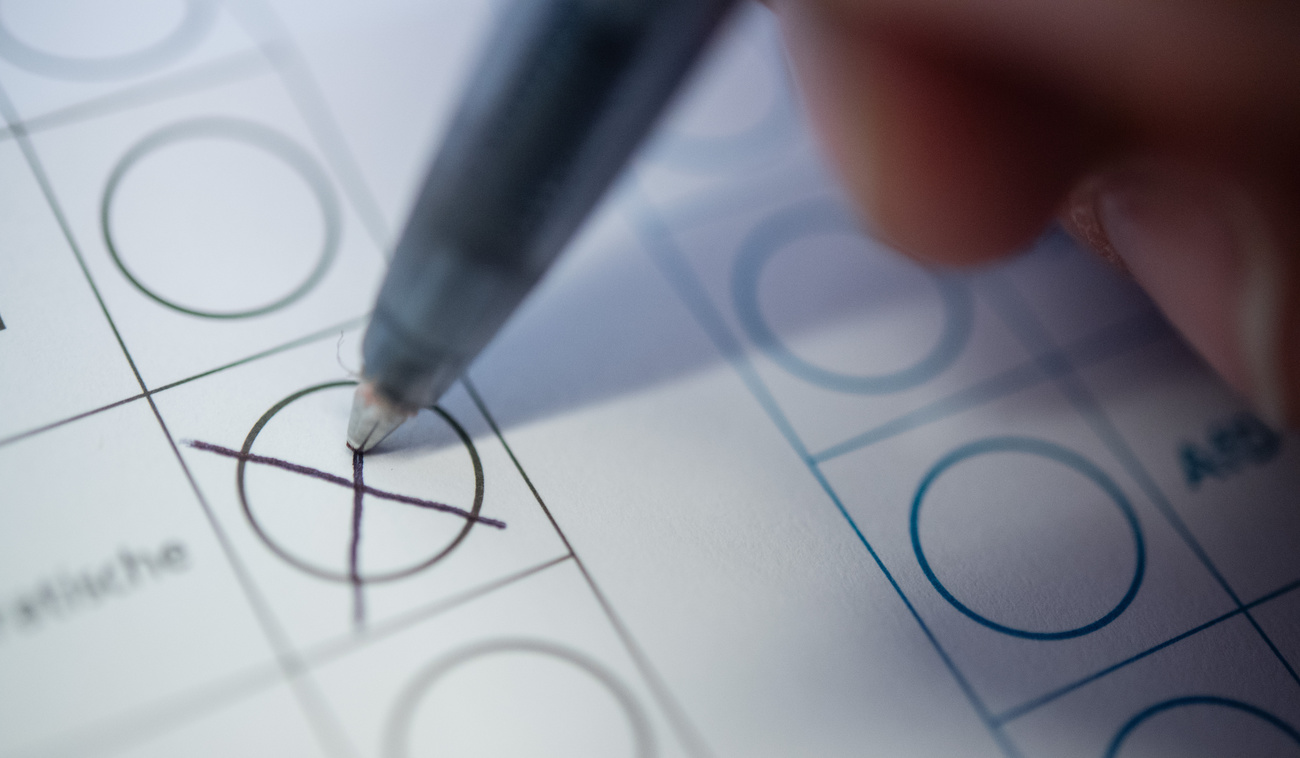




Einen Überblick über die laufenden Debatten mit unseren Journalisten finden Sie hier. Machen Sie mit!
Wenn Sie eine Debatte über ein in diesem Artikel angesprochenes Thema beginnen oder sachliche Fehler melden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an german@swissinfo.ch