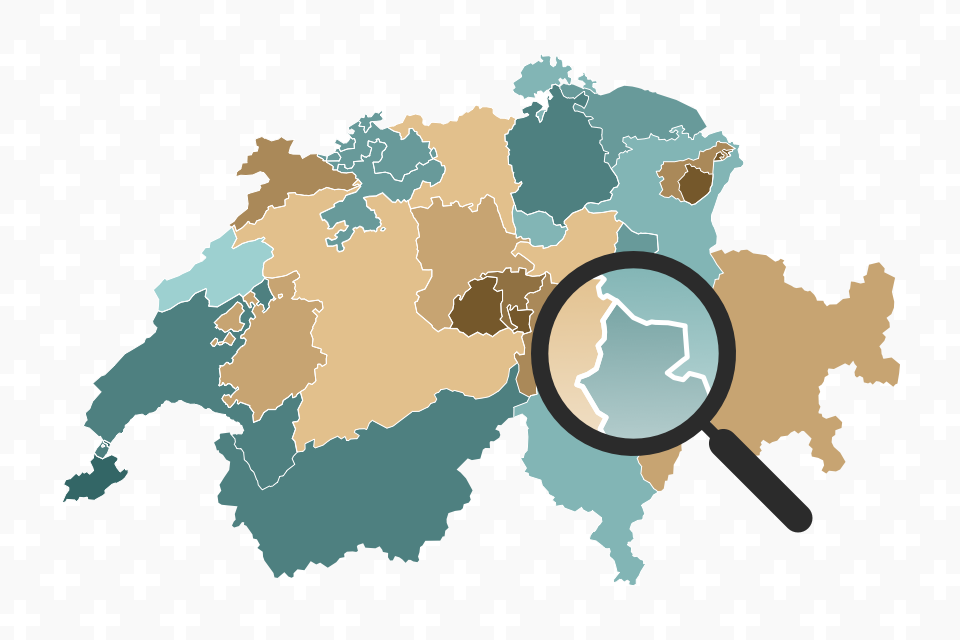Heute in der Schweiz
Liebe Schweizerinnen und Schweizer im Ausland
Der Bundesrat hat gestern seine Entschuldigung bei den Jenischen und Sinti bekräftigt. Dies, nachdem ein Rechtsgutachten ihre Verfolgung im 20. Jahrhundert nach heutigem Völkerrecht als «Verbrechen gegen die Menschlichkeit» gewertet hatte.
Weiter geht es im heutigen Briefing um ein Interview mit Helene Budliger Artieda, Chefin des Staatssekretariats für Wirtschaft Seco, um die neusten Zahlen zur Zuwanderung und die Wahrnehmung der Schweiz in der ausländischen Presse.
Beste Grüsse aus Bern

Die Verfolgung der Jenischen und Sinti ist nach heutigem Völkerrecht als «Verbrechen gegen die Menschlichkeit» zu bezeichnen. Zu diesem Schluss kommt ein Rechtsgutachten. Und: Der Staat trägt nach heutigem Rechtsverständnis eine Mitverantwortung.
Zwischen 1926 und 1973 wurden durch das Programm der Stiftung «Pro Juventute» jenische Kinder ihren Eltern weggenommen und zwangsweise in Heimen, Erziehungsanstalten und bei Pflegefamilien versorgt. Auch Sinti waren davon betroffen. Erwachsene, die als Minderjährige fremdplaziert worden waren, wurden unter Vormundschaft gestellt, in Anstalten untergebracht, mit einem Eheverbot belegt und in Einzelfällen auch zwangssterilisiert.
Systematisch erfasst sind in erster Linie die Wegnahmen durch «Pro Juventute». Daneben agierten aber auch kirchliche Hilfswerke und Behörden, sodass von gegen 2000 Fremdplatzierungen ausgegangen werden muss.
In den 1990er-Jahren hatten Bundesrat und Parlament Wiedergutmachung beschlossen, und der Bundesrat hatte sich 2013 entschuldigt. Doch die Jenischen in der Schweiz verlangten vor drei Jahren, dass die Verfolgung als Genozid – also als Völkermord – anerkannt wird.
Nach dem neuen Rechtsgutachten sind Kindswegnahmen, die beabsichtigte Zerstörung von Familienverbänden zur Eliminierung der fahrenden Lebensweise und zur Assimilierung der Jenischen und Sinti «Verbrechen gegen die Menschlichkeit». Allerdings liege aus rechtlicher Sicht kein (kultureller) Genozid vor, einen Tatbestand «kultureller Genozid» gebe es im Völkerrecht nicht.
Der Bundesrat hat gestern die Ergebnisse zur Kenntnis genommen und Innenministerin Elisabeth Baume-Schneider betonte die Wichtigkeit, an diese Ungerechtigkeiten zu erinnern.
- Der Artikel bei SRFExterner Link.
- Die Meldung von Keystone-SDA bei SWI swissinfo.ch.

Helene Budliger Artieda, Direktorin des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco), äusserte sich in einem Interview mit dem Tages-Anzeiger zu Handelsabkommen mit den USA und zu Lohndumping.
Auf die Frage nach den möglichen Entwicklungen mit den USA gab Budliger Artieda zu, dass Prognosen unter der Trump-Administration schwierig seien. «Es gibt fast täglich neue Ankündigungen.» Sie stelle jedoch in Frage, ob die USA den Schweizer Markt als eine wichtige Priorität betrachten.
Budliger Artieda fügte hinzu, dass «wir schon seit langem genau das tun, was die amerikanische Regierung will». Seit dem Amtsantritt der neuen Regierung haben weder Budliger Artieda noch Wirtschaftsminister Guy Parmelin Washington besucht. Dies, obwohl Buldiger Artiega die Notwendigkeit eines solchen Besuchs betont, um die Beziehungen zu stärken.
Beim Thema Freihandel bekräftigt sie die Offenheit der Schweiz: «Wir sind immer daran interessiert, Freihandelsabkommen zu schliessen – egal wann, egal wo.» Es gebe aber auch Grenzen: «Nein, mit Russland werden wir das nicht machen.»
Zum Freihandelsabkommen mit China erklärte Budliger Artieda, dass wirtschaftliche Interessen nicht über Menschenrechten stünden. «Wir sind die einzige westliche Nation, die einen Dialog zu Arbeitnehmerrechten mit China führt», sagte sie. Dazu gehöre insbesondere die Situation der Uiguren.
Mit Blick auf Europa bekräftigte Budliger Artieda die wichtige Rolle der EU für die Schweizer Wirtschaft und bezeichnete sie als den wichtigsten Absatzmarkt für viele Schweizer Unternehmen. Sie betonte auch die Notwendigkeit der Personenfreizügigkeit, auf die viele Unternehmen in der Schweiz angewiesen seien, um ihren Personalbedarf zu decken.
- Der Artikel im Tages-AnzeigerExterner Link. (Paywall)
- Die Meldung von Keystone-SDA bei SWI swissinfo.ch.
Mehr

Im vergangenen Jahr sind weniger Menschen in die Schweiz eingewandert. Die Mehrheit sei zusammen mit Familienangehörigen eingereist, wie das Staatssekretariat für Migration (SEM) mitteilt.
2024 seien 170’607 Personen in die ständige ausländische Wohnbevölkerung der Schweiz zugewandert, was einem Rückgang von sechs Prozent gegenüber dem Vorjahr entspreche. Die Zuwanderung aus dem EU/EFTA-Raum habe mit über 120’000 Personen gut 70 Prozent der Gesamtzuwanderung ausgemacht, das sind 7,6 Prozent weniger als im Jahr davor. Aus Drittstaaten wanderten laut dem SEM gut 50’000 Personen ein (-2,4 Prozent).
Insgesamt seien im Vergleich zu 2023 5,9 Prozent mehr EU/EFTA-Angehörige und 1,3 Prozent Drittstaatsangehörige aus der Schweiz weggezogen. Ende 2024 lebten 2’368’364 Ausländerinnen und Ausländer dauerhaft in der Schweiz.
- Der Beitrag bei SRFExterner Link.

Medien im Ausland berichteten 2024 weniger kritisch über die Schweiz, wie die Ergebnisse des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA) zeigen.
Internationale Medien würden die Schweiz oft mit positiven, teilweise stereotypen Merkmalen wie Bergen, schöner Landschaft, Schokolade, Uhren und Wohlstand assoziieren.
Von der breiten Bevölkerung im Ausland besonders positiv bewertet wurden im vergangenen Jahr die hohe Lebensqualität, die wirtschaftliche Stabilität, die Innovation und die Neutralität der Schweiz. Gerade Letztere wird wieder besser bewertet als 2022, als die Beurteilung nach Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine vorübergehend kritischer ausfiel.
Das grösste internationale Medienecho im Zusammenhang mit der Schweiz zog 2024 die Konferenz zum Frieden in der Ukraine auf dem Bürgenstock auf sich – mit weltweit positiver Berichterstattung, ausser in Russland. Die Fortschritte bei den Verhandlungen mit der EU wurden ebenfalls positiv aufgenommen, auch wenn die Schweiz von einigen Medien immer noch als «Rosinenpickerin» kritisiert wurde.
Der Schweizer Bankensektor geniesst trotz der Übernahme der Credit Suisse durch die UBS weiterhin einen guten Ruf, über zwei Drittel der Befragten stuften die Qualität der Schweizer Banken als hoch ein.
Dank Nemos Sieg am Eurovision Song Contest in Malmö erhielt auch die Schweizer Kultur positive Aufmerksamkeit.
Allerdings gab es auch Kritik, besonders bei Themen wie Sterbehilfe und bei antisemitischen Vorfällen. Der grösste Nachteil der Schweiz scheinen von aussen gesehen vor allem die hohen Lebenshaltungskosten zu sein.
- Der Artikel auf 20 MinutenExterner Link.
- Die Meldung von EDAExterner Link.

Die Schweiz im Bild
Schweizer Politikerinnen und Politiker, darunter Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter, Justizminister Beat Jans und SVP-Parlamentarier Thomas Aeschi, sind vor Beginn der Von-Wattenwyl-Gespräche abgebildet. Diese fanden heute zwischen Mitgliedern des Bundesrats und den im Bundesrat vertretenen Fraktionen im Vorfeld der parlamentarischen Sessionen in Bern statt.
Übertragung aus dem Englischen mit der Hilfe von Deepl: Claire Micallef

In Übereinstimmung mit den JTI-Standards