Pandemie offenbart Chiles reale Situation

Covid-19 schlägt in Südamerika mit voller Härte zu. Chile hat mit fast 300'000 Fällen unterdessen Italien und Spanien bei der Zahl der Infektionen übertroffen. Das Gesundheitssystem kommt an seine Grenzen. Zwei Auslandschweizerinnen erzählen, wie sie mit der Krise umgehen und sprechen über ihre Ängste, ihre Familien und ihre Hoffnungen in dieser Zeit des Coronavirus.
Laut den neusten Daten der Weltgesundheits-OrganisationExterner Link (WHO) sind Brasilien, Peru, Chile und Mexiko – in dieser Reihenfolge – die Länder mit der höchsten Anzahl bestätigter Infektionen in Südamerika.
Gleichzeitig platziert das Center for Systems Science and EngineeringExterner Link (CSSE) der Johns Hopkins Universität Chile vor Spanien und Italien. Diese Gesundheitskrise verschärft die soziale Krise, die im Oktober 2019 aufgrund der im Land herrschenden Ungleichheiten explodierte, noch weiter.
Gemäss offizieller Schweizer Statistik (2019) sind 46’418 Schweizer Bürgerinnen und Bürger in Südamerika registriert. 5490 leben in Chile. Dies ist nach Brasilien und Argentinien die drittgrösste Schweizer Community in der Region.
«Ich gleiche einer Klosternonne»
Was die Auslandschweizerinnen Brigitte Ackermann, 72, und Regula Ochsenbein, 71, erzählen, gleicht sich weitgehend. Vielleicht liegt es an der Weisheit des Alters oder an ihren Erfahrungen als Expats: Beide Frauen haben eine klare und präzise Vorstellung der Situation in ihrem Gastland.
Ackermann stammt aus dem Kanton Jura und lebt mit ihrem chilenischen Mann in Viña del Mar. Ochsenbein, geboren in Luzern und aufgewachsen zwischen Basel und Bern, lebt allein in Santiago de Chile, seit ihre Tochter letztes Jahr nach Kanada gezogen ist.
Die beiden Auslandschweizerinnen halten sich an alle Vorgaben der chilenischen Regierung. Darüber hinaus hörten sie auch auf die Empfehlungen aus der Schweiz, die ihnen geholfen hätten, gewappnet zu sein, als das Virus in Chile angekommen sei.
Obwohl ihre Gemeinde erst vor einer Woche eine Ausgangssperre angeordnet hat, setzte sich Ackermann bereits im März freiwillig unter Quarantäne. Denn sie wusste, dass sie fit genug sein musste, um sich um ihren 90-jährigen Ehemann zu kümmern.
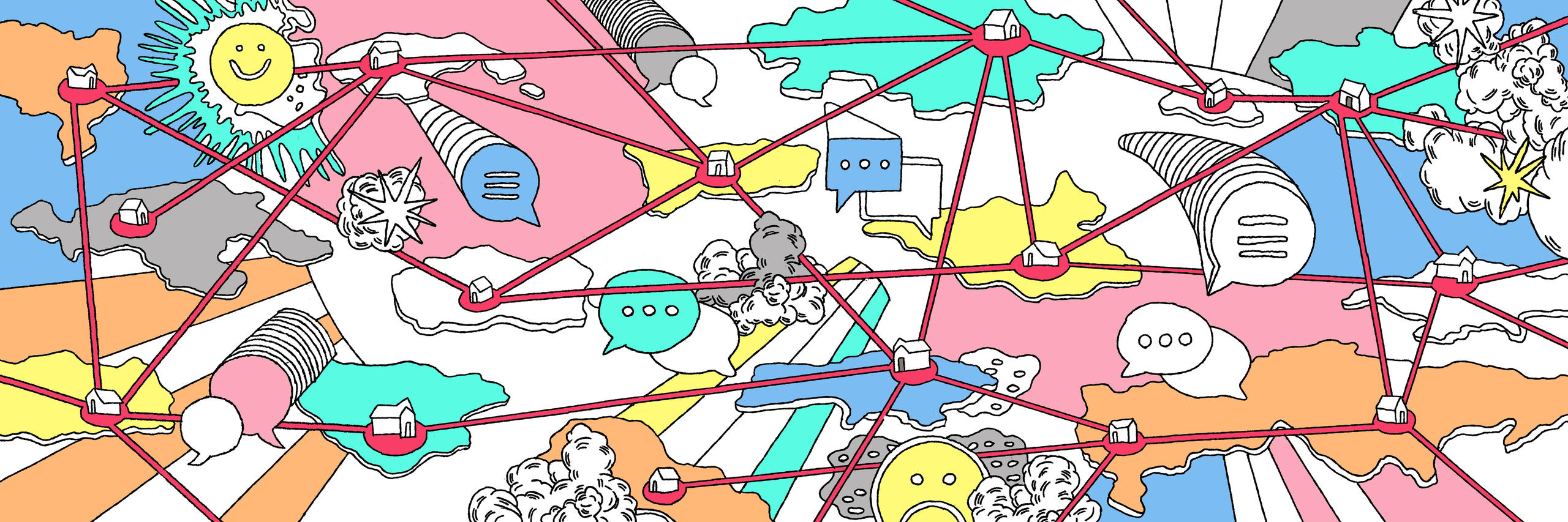
Mehr
Forum für die Fünfte Schweiz
Ochsenbein traf die gleichen Vorkehrungen. «Ich stehe seit Mitte März unter freiwilliger Quarantäne», sagt sie. «Ich hatte damals an der Totenwache eines Arbeiter-Priesters teilgenommen, und dann erfuhren wir, dass mehrere Angehörige des Klerus bereits infiziert waren.»
«Seitdem habe ich nie wieder öffentliche Verkehrsmittel benutzt und gehe nur noch aus dem Haus, um den Gang zu fegen oder an der Ecke Brot zu kaufen. Ich sehe aus wie eine Klosternonne! In meiner Gemeinde (Gran Santiago) dauert die obligatorische Quarantäne etwa sieben Wochen.»
Die Schweiz, die Familie und die Ängste
Die Abwesenheit von Familie und Freunden in Extremsituationen kann Ängste und Sorgen wecken, die unter «normalen» Umständen nicht existieren. Etwas weiteres, das die beiden Frauen gemeinsam haben, ist ihr Mut.
«Ich habe meine Familie in der Schweiz: Meine zwei Kinder und zwei Enkelkinder leben in Lausanne und Neuenburg», sagt Ackermann. Sie versichert, dass sie zu keinem Zeitpunkt an eine Rückkehr in ihr Land gedacht habe, als die Krise ausgebrochen sei. Nicht nur, weil die Pandemie noch nicht vorbei ist, sondern auch, weil sie seit einem Jahrzehnt mit ihrem Mann in Chile lebt.
«Ich hatte keine Angst um meine Familie, weil sie sich gut um sich selber kümmerte und die Schweiz strenge Massnahmen verfügt hatte, die gut eingehalten wurden. Meine Tochter hatte mehr Angst um uns. Ich bin nicht von Natur aus ängstlich. Ich bin positiv und zuversichtlich im Leben. Ich glaube an meine Intuition», sagt Ackermann, die auch die chilenische Vertreterin im AuslandschweizerratExterner Link ist.
Auch Ochsenbein, die viele Jahre in der Schweizer Botschaft in Chile tätig war, hat ihre Familie wie auch die Freunde aus Schule und Universität in ihrem Heimatland zurückgelassen. Doch es kam ihm nie in den Sinn, wegen der Pandemie zurückzukehren.
«Ich habe keine Angst, dass ich sie nicht wiedersehe, denn die Schweizerinnen und Schweizer sind disziplinierter bei der Einhaltung der von den Behörden auferlegten Einschränkungen, und das Gesundheitssystem ist ausgezeichnet. Hier habe ich ein Haus mit sechs Hunden und kann auf 40 Jahre meines Lebens in Chile mit chilenischen Freunden zurückblicken», sagt sie.
«Ich fühle mich sicher, weil ich nicht ausgehe. Ich spreche von Tür zu Tür mit meinen Nachbarn und über Whatsapp mit meinen Freunden. Ich kaufe online, was ich brauche, und ich war noch nie paranoid. Ich wasche mir immer die Hände und esse gut, um meine Abwehrkräfte aufrechtzuerhalten, denn niemand ist immun», so Ochsenbein.
«Hilfe für die Armen vergessen»
Als die Pandemie am 3. März Chile erreichte, waren die Wunden der sozialen Explosion, die im Oktober 2019 durch wachsende Ungleichheit und Armut ausgelöst worden waren, noch nicht verheilt. Dies brachte die Schwäche der Regierung noch deutlicher zum Vorschein.
«Ich kann nicht leugnen, dass ich Angst verspürte und manchmal unter Schlaflosigkeit leide», verrät Ochsenbein. «Nicht so sehr wegen mir, sondern wegen jenen, die nicht die gleichen Vorsichtsmassnahmen treffen können, die sich entscheiden müssen, ob sie mit dem Risiko, sich anzustecken, zur Arbeit gehen oder sich in überfüllten Sozialwohnungen oder prekären Bauten einsperren und vor Hunger sterben.»
Ackermann teilt diese Sorge. Sie hält die Situation für «katastrophal», besonders in Santiago de Chile. «Die Pandemie offenbart die reale Situation im Land», sagt sie. «Es ist sehr schwierig, die von der Regierung beschlossenen Gesundheitsmassnahmen umzusetzen, ohne den Armen zu helfen.»
Die beiden Auslandschweizerinnen sind der Ansicht, dass die Regierung spät reagiert hat und die wirtschaftliche Lage vieler Menschen es nicht erlaubt, diese Massnahmen ohne ausreichende staatliche Unterstützung einzuhalten. Gesundheitspolitik könne nicht erfolgreich sein, wenn sie nicht Hand in Hand mit der Sozial- und Wirtschaftspolitik gehe. Jene, die aus Protest auf die Strasse gegangen seien, weil sie ausser ihrem Leben nichts zu verlieren hätten, seien die gleichen Leute, die in den Vororten der Grossstädte Suppenküchen organisierten, sagt Ochsenbein.
«Auf der Ebene des Gesundheitswesens funktioniert die Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor nicht gut, während das in so schwierigen Zeiten wie denen, die wir durchleben, notwendig wäre», sorgt sich Ackermann.
Ohne die Hoffnung aufzugeben, glauben die beiden Schweizerinnen, dass sich nach dieser beispiellosen globalen Krise, der Covid-19-Pandemie, nichts wirklich ändern wird…

Mehr
Coronavirus: Die Situation in der Schweiz

In Übereinstimmung mit den JTI-Standards

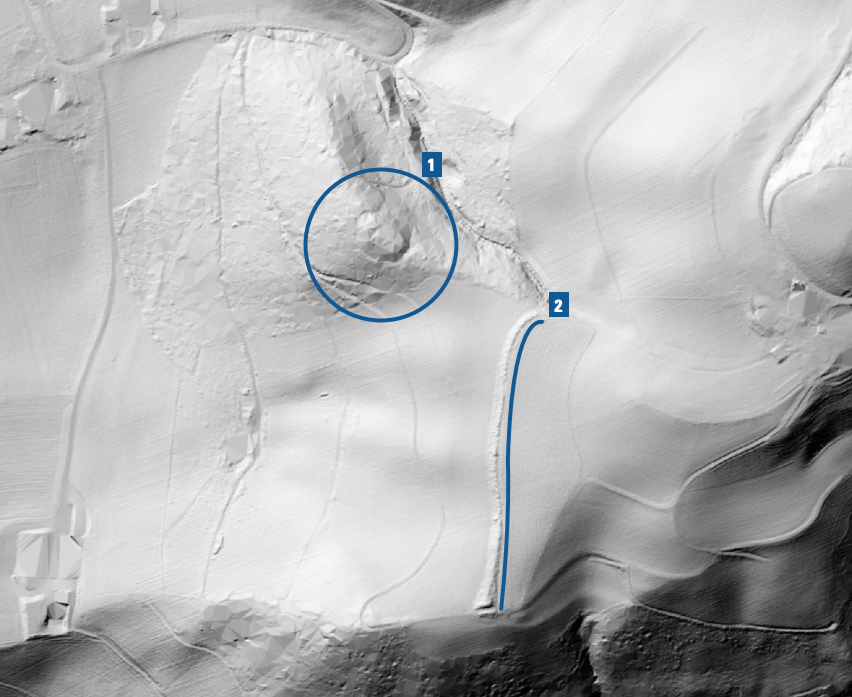











Einen Überblick über die laufenden Debatten mit unseren Journalisten finden Sie hier. Machen Sie mit!
Wenn Sie eine Debatte über ein in diesem Artikel angesprochenes Thema beginnen oder sachliche Fehler melden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an german@swissinfo.ch