Wenn Patienten sich selbst versorgen
In einem Gesundheitssystem, in dem sich die Beziehung zwischen Arzt und Patient:in verändert hat, sind manche Menschen auf sich allein gestellt. Xavière, eine 44-jährige Patientin aus dem Wallis, hat dies erlebt. Nach monatelangen Rückenschmerzen und einer Fehldiagnose musste sie sich selbst helfen, um die richtige Behandlung zu erhalten.
Im Januar letzten Jahres konnte ein Neurochirurg mangels Kontrastmittel auf dem MRT nichts Schlimmes feststellen und entliess sie mit ein paar Physiotherapien und einem Termin sechs Wochen später, um zu sehen, wie sich die Situation entwickelt hat.
Die Schmerzen halten jedoch an. Eine weitere MRT-Untersuchung zeigt einen gutartigen Tumor im Rückenmark. „Die Schmerzen waren erklärbar, aber nur aufgrund eines Berichts, um den ich betteln musste, weil ich ihn nicht erhalten hatte“, erklärt die Walliserin, die von ihrem Neurochirurgen nie wieder kontaktiert wurde.

Mehr
Die Top-Geschichten der Woche abonnieren
Um ihre Schmerzen sieben Monate später in Worte zu fassen, braucht sie die Hilfe ihrer Shiatsu-Therapeutin, die die Bilder an ihren Lehrer weiterleitet, der das Problem erkennt und ihr empfiehlt, sich an das Universitätsspital Genf zu wenden.
Xavière nimmt die Sache selbst in die Hand und kontaktiert die Spezialisten. Sie leitet die Unterlagen weiter und wird schliesslich im März operiert. Ohne Operation hätte ihr eine Querschnittslähmung gedroht.
Eine Veränderung der Arzt-Patienten-Beziehung
Dieser Parcours veranschaulicht den Wandel in der Beziehung zwischen Arzt und Patient, der vor fünfzig Jahren begann. Vincent Barras, Medizinhistoriker an der Universität Lausanne, erklärt, dass sich die Medizin von einer paternalistischen Beziehung, dem allwissenden Arzt, zu einer eher horizontalen Beziehung entwickelt hat, die auch ihre Vorteile habe.
«Der Patient ist viel mehr auf sich selbst gestellt. Er wird viel mehr als autonom angesehen. Das frühere Modell bedeutete eine Art Unterwerfung unter ein Modell, das nicht in Frage gestellt wurde», erklärte der Historiker gegenüber RTS.
«Heute ist es auffällig, wie sehr der globale Diskurs uns zu Subjekten macht, die für ihre Krankheit verantwortlich sind.»
Vincent Barras, Medizinhistoriker an der Universität Lausanne.
Diese Entwicklung hängt mit der Individualisierung der Gesellschaft und dem wissenschaftlichen Fortschritt zusammen, der die medizinischen Disziplinen zersplittert und eine ganzheitliche Sicht auf die Gesundheit einer Person erschwert hat.
«In einer neoliberalen Konsumgesellschaft wird das Individuum zum Kern, an dem alles andere gemessen wird», analysiert Vincent Barras. Die Erfahrung der Krankheit selbst werde als etwas Individuelles erlebt, und diese Entwicklung lasse sich auch in den Institutionen der Kostenübernahme, wie den Krankenkassen, beobachten.
Er fährt fort: «Heute ist es auffällig, wie sehr der globale Diskurs uns zu Subjekten macht, die für ihre Krankheit selbst verantwortlich sind.» Das zeige sich auch im Präventionsdiskurs, der in diese Richtung gehe und den Menschen fast Angst mache vor der eigenen Verantwortung für den Ausbruch der Krankheit.
Proaktive Krankenhäuser
Xavière befindet sich, wie viele andere Menschen auch, in der Situation, sich über den eigenen Gesundheitszustand zu informieren, ihn zu verwalten und zur Spezialistin zu werden. Diese erzwungene Autonomie kann jedoch zu Einsamkeit und Ängsten führen. „Irgendwie vermisse ich den allwissenden Arzt, der mich dahin führt, wo ich hin muss“, gesteht sie.
Diese Autonomie hat zwar Vorteile, kann aber auch dazu führen, dass Patienten einem komplexen System hilflos gegenüberstehen. Um dieser Einsamkeit entgegenzuwirken, haben einige Krankenhäuser Dienste eingerichtet, die die Erfahrungsberichte der Patienten sammeln und ihnen den Weg erleichtern sollen.
Übertragung aus dem Französischen mithilfe von Deepl: Melanie Eichenberger

In Übereinstimmung mit den JTI-Standards

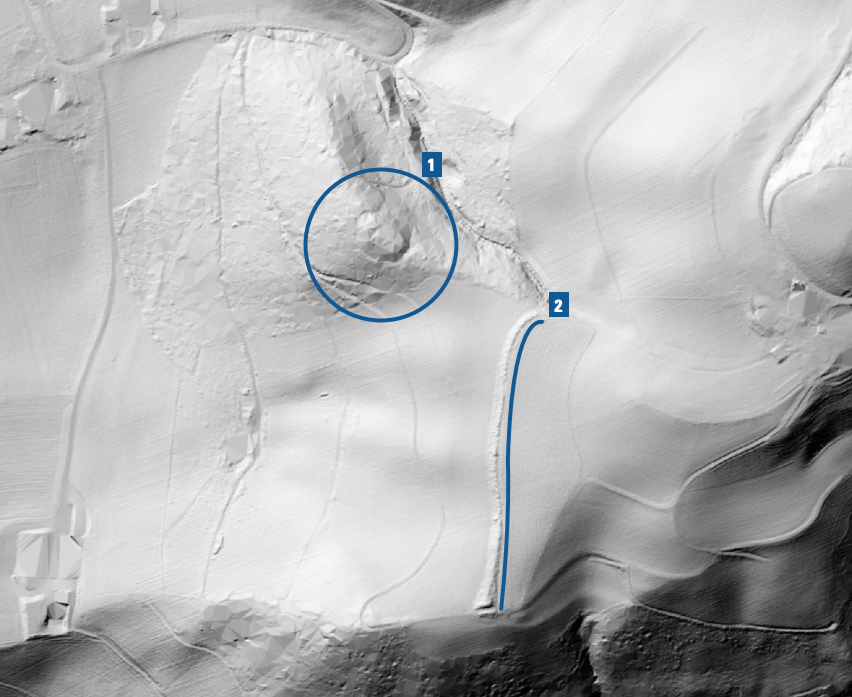











Einen Überblick über die laufenden Debatten mit unseren Journalisten finden Sie hier. Machen Sie mit!
Wenn Sie eine Debatte über ein in diesem Artikel angesprochenes Thema beginnen oder sachliche Fehler melden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an german@swissinfo.ch