Warum dem Pharmaland Schweiz die Medikamente ausgehen

Die Schweiz ist mit zwei der weltgrössten Pharmakonzerne – Roche und Novartis – sowie hunderten kleinerer Biotechfirmen ein unangefochtener Pharmastandort. Wie kann es sein, dass ein Land, das die Welt mit so vielen Medikamenten versorgt, selbst unter Medikamentenmangel leidet?
In den letzten drei Monaten waren die Schweizer Medien voll von Berichten über Lieferengpässe bei Arzneimitteln – vom Antibiotikum Amoxicillin über gängige Schmerzmittel wie Ibuprofen bis hin zu Medikamenten gegen chronische Krankheiten wie Parkinson, Herzerkrankungen und Epilepsie.
Laut der vom Schweizer Apotheker Enea Martinelli ins Leben gerufenen Website drugshortage.chExterner Link waren Anfang März mindestens 1000 verschreibungspflichtige Präparate «nicht verfügbar». Die Zahl ist mehr als doppelt so hoch wie vor zwei Jahren.
Besonders heikel: Darunter sind rund 140 unentbehrliche Medikamente wie das Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung (BWL) diesen März warnte. Auch diese Zahl ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen. 2017 waren erst 48 unverzichtbare Medikamente nicht verfügbar.
Bereits Ende letzten Jahres sagte Martinelli gegenüber dem Schweizer Fernsehen SRF: «Wir haben einen traurigen Rekord erreicht.» Die Schweizer Behörden doppelten nach, im Februar wurde angesichts der «problematischen Lage» eine Taskforce eingesetzt.
Lieferengpässe bei Medikamenten sind in der Schweiz nichts Neues, aber das Fehlen von Medikamenten in den Apothekenregalen, die Geschwindigkeit, mit der sie verschwinden, und die Dauer der Engpässe haben Alarm ausgelöst.
«Vor zwanzig Jahren hatten wir einen Engpass pro Monat. Heute sind es vier bis fünf pro Tag. Das ist besorgniserregend. Seit Anfang des Jahres sind mehr als 150 Medikamente nicht mehr vorrätig», sagte eine Spitalapothekerin im Februar gegenüber der französischsprachigen Zeitung Le TempsExterner Link.
Die Schweiz ist kein Einzelfall. In weiten Teilen Europas kommt es nach der Pandemie und der Aufhebung oder Lockerung der Maskenpflicht zu gravierenden Lieferengpässen bei Medikamenten. Dies hat in diesem Winter zu einem sprunghaften Anstieg von Erkältungen, Atemweginfektionen und Grippefällen geführt.
Eine Blackbox
Nur wenige Länder verfügen über eine so hohe Dichte an Pharmaunternehmen wie die Schweiz. Einer der Hauptgründe, warum es ihr trotzdem nicht gelungen ist, Engpässe zu vermeiden, sei das Fehlen eines umfassenden Überblicks über das Problem, stellte das Bundesamt für Gesundheit (BAG) in einem im Februar veröffentlichten BerichtExterner Link fest.
Das nationale Versorgungsamt erfasst nur Medikamente, die es für unentbehrlich hält. Die einzige andere Quelle ist Martinellis Website über verschreibungspflichtige Medikamente, die als unabhängige Initiative erstellt wurde und auf den Meldungen der Hersteller, Apothekerinnen und Apotheker basiert. Freiverkäufliche Arzneimittel wie Hustensaft werden dort nicht erfasst.
Darüber hinaus sind verschiedene Behörden für unterschiedliche Teile der Arzneimittelversorgungskette zuständig. Die Hauptverantwortung für die Deckung des Bedarfs der Patientinnen und Patienten und die Beschaffung der Arzneimittel liegt bei den Kantonen, während das BAG für die Preisfestsetzung und die Rückerstattung zuständig ist.
Daneben gibt es das Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung, das für die Überwachung und Lagerung lebenswichtiger Güter zuständig ist. Und die nationale Arzneimittelbehörde Swissmedic, die für die Zulassung von Arzneimitteln, die Überwachung der Sicherheit und der Herstellungspraxis zuständig ist. Das erschwert die Vorhersage und die Bewältigung eines unerwartet schnellen Anstiegs der Nachfrage wie in diesem Winter.
«Wir brauchen Transparenz, um herauszufinden, wo die Schwierigkeiten in der Lieferkette liegen. Nur so können Lieferengpässe vermieden werden», sagt Martinelli gegenüber SWI swissinfo.ch. Als Apotheker fügt er hinzu: «Wenn ich weiss, wie lange es dauert, bis etwas geliefert wird, kann ich entscheiden, was zu tun ist.
Doch Transparenz fehle überall, sagt Kostas Selviaridis, Experte für Beschaffung und Lieferketten an der Lancaster University Management School. «Das ist ein grosses Grundproblem. Wir haben keinen Einblick in die Lieferkette eines bestimmten Produkts.»
Es gibt kaum Informationen darüber, wo ein Produkt hergestellt wird und wie viele Zulieferer daran beteiligt sind. «Wenn man weiss, dass es nur eine einzige Fabrik gibt, die den Rohstoff herstellt, weiss man, dass man diversifizieren muss. Aber diese Informationen werden von den Unternehmen, die die Medikamente herstellen, als Geschäftsgeheimnis behandelt.»
Nicht nachhaltiger» Markt
Die Schweiz als kleiner Absatzmarkt steht ausserdem vor zusätzlichen Herausforderungen. Bei neueren, teuren Medikamenten ist dies kein Problem, wohl aber bei Medikamenten mit geringen Margen.
Fachleute schätzen, dass rund 90% der Lieferengpässe patentfreie Medikamente betreffen, also entweder Originalpräparate, die nicht mehr patentgeschützt sind, oder Generika von Originalpräparaten.
Das BAG legt die Preise sowohl für Markenmedikamente als auch für Generika fest. Letztere müssen mindestens 20 Prozent unter dem Preis des Markenprodukts liegen, damit sie von den Krankenkassen vergütet werden.
Alle paar Jahre überprüft das Bundesamt die Preisdifferenz. In der Regel wird der Preis nach unten angepasst, um die Gesundheitskosten zu senken. Obwohl die Preise für Generika in der Schweiz im Durchschnitt höher sind als im übrigen Europa, wo ebenfalls Preisobergrenzen für Generika gelten, sind die Preise für viele ältere Medikamente unter das Niveau anderer Länder gefallen.
Ein Beispiel ist Ibuprofen, das in den 60er Jahren auf den Markt kam und immer noch eines der am häufigsten verwendeten Schmerzmittel ist. Im Jahr 2003 betrug der Fabrikabgabepreis für eine generische 600-mg-Kapsel (basierend auf einer Packung mit 100 Kapseln) 33 Rappen. Zwanzig Jahre und vier Preisrevisionen später kostet die gleiche Kapsel ab Werk nur noch neun Rappen.
Angesichts steigender Kosten, von der Energie bis zur Verpackung, hat der Generikamarkt «ein Niveau erreicht, das wirtschaftlich nicht mehr tragbar ist», sagt Lucas Schalch, Geschäftsführer des Schweizerischen Generikaverbands Intergenerika, gegenüber SWI swissinfo.ch. Martinelli schätzt, dass rund drei Viertel der 1000 nicht mehr erhältlichen Medikamente weniger als 50 Franken kosten.
Dies bestätigt auch einer der grössten Generikahersteller, die israelische Teva, zu der auch der Schweizer Generikahändler Mepha gehört. Ein grosses Problem sei der «immense Preisdruck, vor allem bei Medikamenten im untersten Preissegment», sagt eine Unternehmenssprecherin gegenüber SWI.
Je niedriger die Preise, desto unattraktiver wird der Markt für die Hersteller. Deshalb gibt es für manche Medikamente nur noch wenige Anbieter. Nach Angaben des Marktforschungsunternehmens IQVIAExterner Link haben beispielsweise nur fünf Unternehmen einen Anteil von fast 60 % am europäischen Amoxicillin-Markt.
Schweiz in grosser Abhängigkeit
Die Situation in der Schweiz ist besonders besorgniserregend. Als kleines Land ist sie stärker von einem einzigen Anbieter abhängig. Oft sogar von einer patentfreien Originalmarke, weil es sich für die Generikahersteller nicht lohne, ihr Produkt hierzulande registrieren zu lassen, sagt Martinelli.
«Wir haben einige Medikamente, deren Patent abgelaufen ist und für die es keine generischen Alternativen gibt. Wenn sie fehlen, haben wir nichts», sagt Martinelli und nennt als Beispiel die Marke Aldactone zur Behandlung von Herzinsuffizienz. Pfizer ist der einzige Anbieter dieses Medikaments in der Schweiz, in Deutschland gibt es sechs verschiedene Generika.
Das erklärt, warum es auch bei Medikamenten für chronische Krankheiten wie Epilepsie zu Engpässen kommt. Die Nachfrage sei nicht gestiegen, sagt Martinelli, aber es gebe weniger Anbieter.
Gemäss der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD)Externer Link machen die Generika in der Schweiz nur 27% des Medikamentenmarkts aus, gegenüber 83% in Deutschland, 49% in Japan und 78% in Kanada.
Internationale Verflechtungen
Es gibt nicht nur weniger Lieferanten, sondern ihre Lieferketten sind auch globaler, komplexer und voneinander abhängig geworden. Im Wettlauf um Kostensenkungen verlassen sich die Arzneimittelhersteller zunehmend auf Dritte, vor allem im Ausland. Das macht die Länder anfälliger für Konjunkturschwankungen, geopolitische Ereignisse und Lieferengpässe.
2021 exportierte die Schweiz pharmazeutische Produkte im Wert von 47 Milliarden Franken und war damit die zweitgrösste Exporteurin von Arzneimitteln weltweit. Dabei handelt es sich vor allem um patentgeschützte, neuere Medikamente und Substanzen. Viele der am häufigsten verwendeten Arzneimittel wie Antibiotika oder Insulin stammen fast ausschliesslich aus dem AuslandExterner Link.
In der Schweiz gibt es nur zwei Produktionsstätten für Generika: Streuli Pharma AG in Uznach, Kanton St. Gallen, und Bichsel in Interlaken, Kanton Bern.
Auch wenn Generika oder patentfreie Marken in der näheren Umgebung produziert werden, kommen die Wirkstoffe zunehmend aus dem Ausland. Damit hat die Schweiz das gleiche Problem wie andere Länder: die Abhängigkeit von Dritten, die vor allem in Asien angesiedelt sind.
Genaue Zahlen gibt es nicht. Aber eine Studie der Europäischen KommissionExterner Link hat ergeben, dass 80% der nach Europa importierten pharmazeutischen Wirkstoffe (API) aus nur fünf Ländern stammen. 45% kommen aus China, der Rest aus Indien, Indonesien, den USA und Grossbritannien.
Als die indische Regierung auf dem Höhepunkt der ersten Covid-Welle im April 2020 Exportbeschränkungen auf Wirkstoffe für Schmerzmittel wie Paracetamol verhängte, suchten Apothekerinnen und Patienten in der Schweiz händeringend nach Alternativen.
Der Brexit und der Fachkräftemangel in Grossbritannien, Exportbeschränkungen in China und der Krieg in der Ukraine, einem wichtigen Lieferanten von Glas für Arzneimittelfläschchen, haben die Engpässe noch verschärft.
Das Ende der Innovation
Auch wenn die akute Knappheit nach den Wintermonaten abklingen dürfte, warnen die Apotheken davor, dass sich die Situation verschärfen wird, wenn die zugrunde liegenden Probleme nicht angegangen werden. Ein wichtiger Lösungsansatz, der in der Schweiz und in Europa diskutiert wird, ist die Verlagerung der Produktion in die Nähe des Absatzmarkts.
Die EU revidiert derzeit ihre Arzneimittelgesetzgebung und will einige Vorschläge unterbreiten. Eine gesamteuropäische Lösung wäre auch im Interesse der Schweiz, sagt Schalch. Fachleute befürchten aber, dass sich die Regierungen zu sehr auf Generika konzentrieren, obwohl die Probleme viel systemischer sind.
Mehr
Roche-Chef Severin Schwan hat kürzlich auf der Bilanzpressekonferenz des Unternehmens Fragen zu Lieferengpässen bei Medikamenten mit dem Hinweis zurückgewiesen, es handle sich um Generika, und «das ist kein Bereich, in dem wir tätig sind».
«Bei neuen Medikamenten sind die Lieferketten völlig stabil und wir können unsere Medikamente überall in vollem Umfang zur Verfügung stellen», so Schwan weiter.
Aber die Auslagerung findet oft schon vor Ablauf des Patentschutzes statt. Die Generikahersteller beziehen ihre Rohstoffe nicht mehr von Roche und Novartis, sondern aus Asien. Wenn sich die Produktion nicht mehr lohne, gingen die Firmen pleite und stellten das Medikament nicht mehr her, sagt eine Sprecherin des Schweizer Apothekerverbands Pharmasuisse.
Gemessen am Volumen der Endprodukte kommt etwa die Hälfte der Wirkstoffe von Roche aus Europa, ein Viertel aus Asien und ein Fünftel aus Lateinamerika. Das Unternehmen stellt auch noch einige patentfreie Originalpräparate in der Schweiz her, wie beispielsweise das Antibiotikum Rochephin.
«Diese grossen Unternehmen können dazu beitragen, dass es weniger Probleme gibt, wenn ihre Patente auslaufen», sagt die Pharmasuisse-Sprecherin.
Wie Covid-19 gezeigt hat, sind die Patientinnen und Patienten auf diese älteren Medikamente angewiesen. «Das ganze System basiert auf der Idee, dass ein Medikament 20 Jahre lang geschützt ist und dann billige Kopien auf den Markt kommen», sagt Patrick Durisch, Leiter der Abteilung für öffentliche Gesundheitspolitik bei der NGO Public Eye. «Dieses System von erster und zweiter Klasse ist ein gefährliches Spiel.»
Editiert von Virginie Mangin/gw, Bildmaterial von Kai Reusser und Pauline Turuban, Übertragung aus dem Englischen: Christian Raaflaub
Übertragung aus dem Englischen: Christian Raaflaub

In Übereinstimmung mit den JTI-Standards









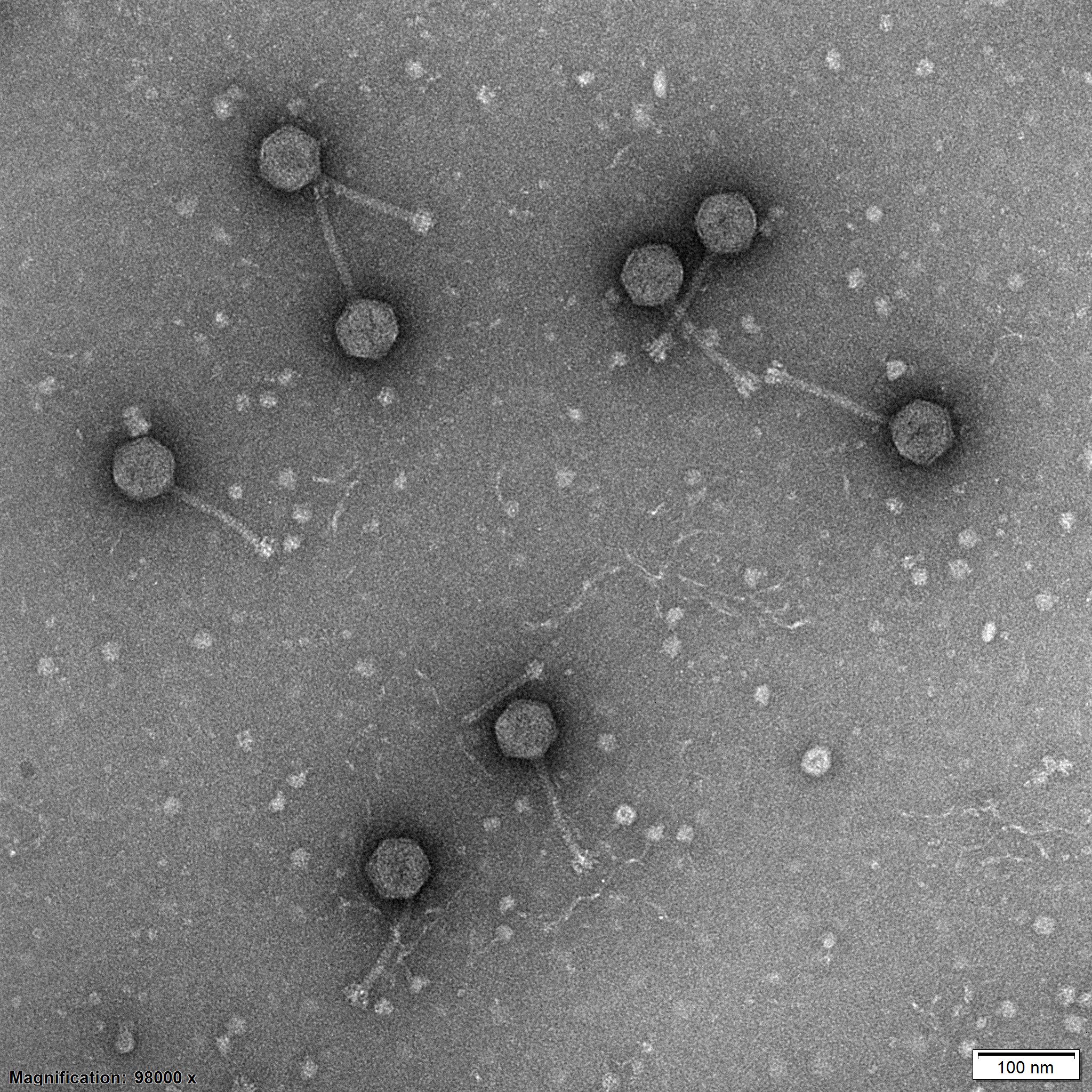





Einen Überblick über die laufenden Debatten mit unseren Journalisten finden Sie hier. Machen Sie mit!
Wenn Sie eine Debatte über ein in diesem Artikel angesprochenes Thema beginnen oder sachliche Fehler melden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an german@swissinfo.ch