Der wichtige Beitrag der Medizinstudentinnen und Medizinstudenten

Die Coronavirus-Pandemie hat die Schweizer Spitäler zu einer drastischen Reorganisation gezwungen. Viele Medizinstudenten und Medizinstudentinnen stellen sich Stationen von Spitälern zur Verfügung, wo sie am meisten gebraucht werden, vor allem auf den Intensivstationen. Wir haben mit drei von ihnen gesprochen.
Seit der Entdeckung des ersten Falls einer Coronavirus-Infektion in der Schweiz ist mehr als ein Monat vergangen. Mit dem Blick auf die Geschehnisse in Italien wurde bald klar, dass die Epidemie auch für die Schweizer Krankenhäuser kein Kinderspiel werden würde. Es zeichnete sich ab, dass die Gesundheitseinrichtungen trotz Massnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Virus mit einem Personalmangel konfrontiert sein würden.
Das Universitätsspital Genf (HUG) lancierte einen Aufruf zur Solidarität und bat Personen mit den entsprechenden Fähigkeiten um Hilfe. Etwa 800 Personen meldeten sich, von denen 140 verpflichtet wurden. Dazu gehörten Studierende der Pflegefachhochschulen, der Physiotherapie und natürlich der medizinischen Fakultät.
Die Pandemie hat den Lehrplan vieler Studierender erheblich verändert. So auch für Baptiste. Er befand sich für ein Praktikum in Nepal und musste nach Europa zurückkehren, bevor die Flughäfen geschlossen wurden, erzählt er.
«Als ich die Situation sah, dachte ich, dass ich als Freiwilliger in der Notaufnahme oder auf der Intensivstation, wo Personal benötigt wird, nützlicher wäre.» Er landete am 22. März in der Schweiz und war bereits am 26. März im Einsatz.
Auch Mélanie, die ein Praktikum auf der Kinderstation des Neuenburger Spitals absolvierte, und Lauranne, die sich in Genf auf der Anästhesiestation befand, meldeten sich. Laurannes Station war eine der ersten, die zur Bewältigung der Pandemie umgerüstet wurden.

Ein etwas anderes Praktikum
Alle drei sind Medizinstudierende im sechsten Studienjahr, also in der Zeit, in der sie das Gelernte durch praktische Arbeit in verschiedenen Abteilungen über einen Zeitraum von zehn Monaten in die Praxis umsetzen.
Viermal mehr als normal
In einer normalen Situation beträgt die Zahl der intubierten Patienten auf der Intensivstation des Universitätsspitals Genf 15. Zum Zeitpunkt der Entstehung dieses Artikels waren etwa 60 Personen intubiert.
Für die Spitäler sind die «ältesten» Studierenden als Unterstützung in dieser Situation natürlich hoch willkommen. Aber der Einsatz ist aufgrund der Ansteckungsrisiken freiwillig.
Die drei Studierenden stürzten sich ohne Zögern in diese unerwartete Erfahrung, die sich von einem Praktikum in Normalzeiten erheblich unterscheidet. Natürlich treffen sie aber auch Vorkehrungen.
«Ich bin zu Hause nicht mehr willkommen», sagt Mélanie lachend. «Ich habe zum Glück eine Wohnung zur Verfügung, in der ich während der Quarantäne leben kann. Von dem Moment an, als ich wusste, dass ich auf die Intensivstation gehen würde, sagte ich mir, ich müsse eine Lösung finden. Ich wollte nicht jeden Tag nach Hause kommen, nachdem ich mit Covid-Patienten in Kontakt gekommen war. Ich habe Kollegen, die abends direkt nach dem Heimkommen duschen oder solche, die sich vor dem Betreten des Hauses ausziehen», sagt sie.
Aber die Veränderungen betreffen vor allem den Arbeitsplatz, den sie während ihres Studiums bereits kennenlernten.
«Ich war von der Reorganisation aufgrund der Krise überrascht», sagt Lauranne. «Wie schnell Ratschläge aus Norditalien umgesetzt, alles umgestellt sowie Menschen und Material mobilisiert wurden, um die Epidemie zu stemmen.»
«Die Angehörigen haben Angst, sie sind traurig, und der einzige Kontakt, den sie haben können, ist über das Telefon. Das sind Erfahrungen, die viele zeichnen.» Baptiste, Medizinstudent
Viele Stationen wurden umgebaut, um Platz für die Intensivpflege zu schaffen, die stark erweitert wurde. «Wir arbeiten jetzt in der Einheit, die normalerweise der Reanimation gewidmet ist, aber alles wurde so verändert, dass es sowohl für Covid-Patienten als auch als Operationsstock geeignet ist», beschreibt Baptiste.
Auch die Atmosphäre hat sich stark verändert. «Es ist beunruhigend. Normalerweise sind immer sehr viele Menschen im Spital. Jetzt ist alles abgeriegelt, es gibt keine Angehörigen der Patienten mehr», fügt Mélanie hinzu.
Telefonische Kontakte
Diese Distanz ist für die drei Studierenden einer der wichtigsten Aspekte der gegenwärtigen Situation. «Wir kümmern uns um Menschen, die mit ihren Familien keinen direkten Kontakt haben können», erklärt Baptiste. Die Angehörigen der stationären Patienten werden alle 48 Stunden oder bei einer deutlichen Verbesserung oder Verschlechterung des Gesundheitszustandes telefonisch kontaktiert.
«Es ist wirklich seltsam, nur telefonischen Kontakt zu haben», sagt Mélanie. «Solche Dinge werden normalerweise persönlich mit Verwandten besprochen.»
«Wir organisieren auch Videokonferenzen mit Familien, wenn sie ihre Lieben sehen wollen, die sehr oft in einem künstlichen Koma liegen. Die Menschen haben Angst, sie sind traurig, und der einzige Kontakt, den sie haben können, ist über das Telefon. Das sind Erfahrungen, die viele zeichnen», sagt Baptiste.
Ein Tag auf der Intensivstation
Die Tage sind lang. Am Morgen, nach dem Wechsel des Personals der Abend- und Tagesschicht, sind die drei Studierenden bei der medizinischen Visite aller Patienten dabei. Dabei werden die Patienten insbesondere auf ihren Bewusstseinszustand, die Atmung und das Funktionieren der Nieren überprüft, um über Änderungen der Medikation oder des Beatmungsgeräts zu entscheiden.

Mehr
Wie viele Spitalbetten hat die Schweiz im internationalen Vergleich?
Wer in direkten Kontakt mit den Patienten kommt, muss zwingend entsprechende Schutzkleidung tragen, um eine Ansteckung möglichst zu verhindern.
Auch viele administrative Arbeiten fallen für die drei Praktikanten an. Bei jedem Patienten muss exakt aufgeschrieben werden, was getan wurde. Zudem wird ein «Journal» geführt, das dem Patienten helfen kann, sobald er aus dem Koma erwacht.
«Wenn Menschen intubiert werden, erinnern sie sich an nichts, sie verpassen etwa zwei Wochen. Deshalb schreiben wir jeden Tag auf, was passiert. Zum Beispiel, dass wir die Beatmung verringern konnten, dass es etwas besser geht und so weiter. So können sie ihre Krankheitsgeschichte nachträglich ein wenig zurückverfolgen», erklärt Mélanie.
Aber auf der Intensivstation gibt es keine wirkliche Routine, schon gar nicht in einer Situation wie der gegenwärtigen. «Es kann jederzeit etwas passieren, und man muss sich das sofort ansehen. Ich habe gelernt, flexibler zu sein und mich daran zu gewöhnen, nicht zu wissen, wie es morgen sein wird. Manchmal ist es relativ ruhig, an anderen Tagen können wir keinen Moment innehalten», sagt Lauranne. «Ausserdem wissen wir nicht, wie sich die allgemeine Situation entwickeln wird».
«Die Tage auf der Intensivstation sind schwierig, körperlich und mental», sagt Mélanie. «Wir beginnen um 7.30 Uhr und machen abends gegen 20:00 Uhr Schluss. Auch moralisch ist es schwer: die Menschen in diesem Zustand zu sehen, die Familie kontaktieren zu müssen… Aber ich kann nicht sagen, dass es zu viel ist. Es gelingt uns, mit der Situation umzugehen.»
(Übertragung aus dem Italienischen: Sibilla Bondolfi)

In Übereinstimmung mit den JTI-Standards












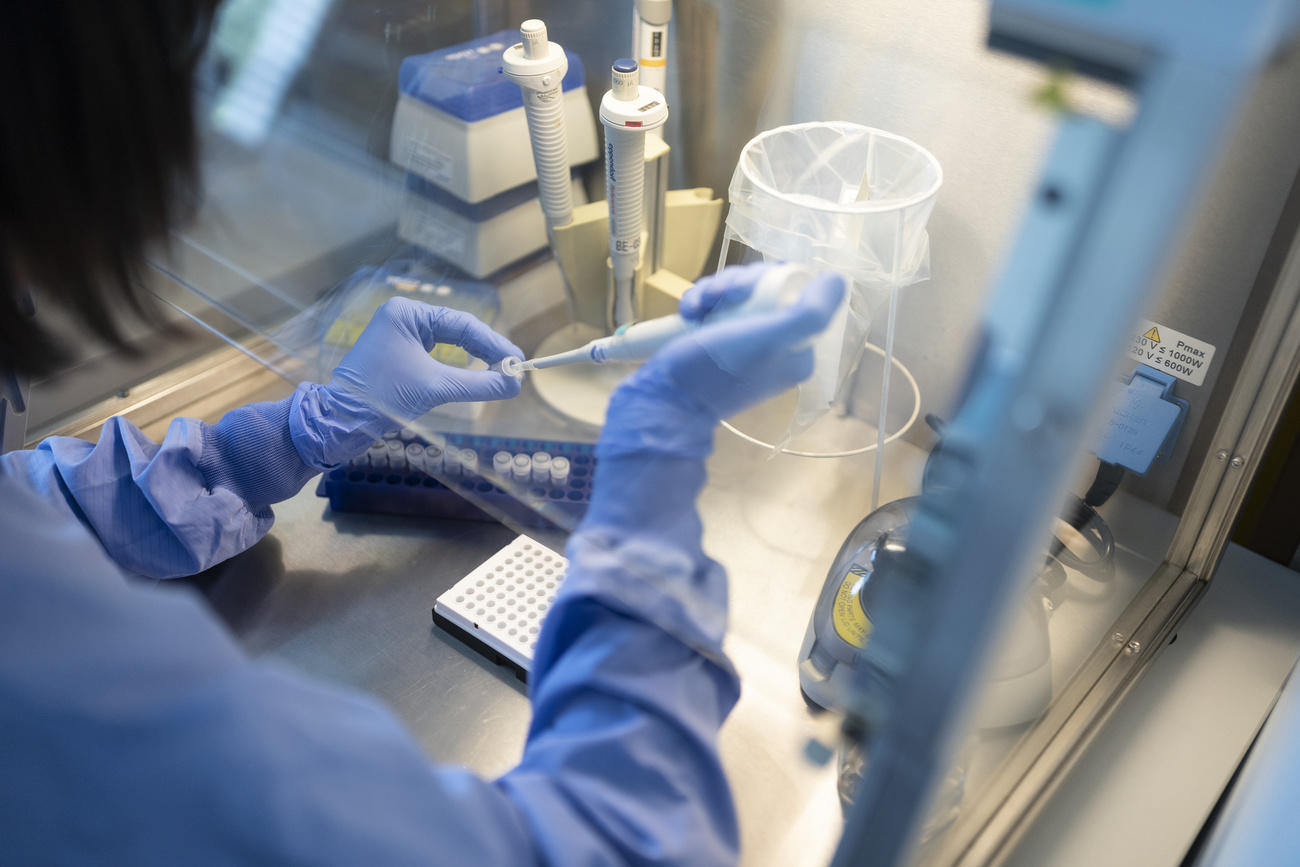
Einen Überblick über die laufenden Debatten mit unseren Journalisten finden Sie hier. Machen Sie mit!
Wenn Sie eine Debatte über ein in diesem Artikel angesprochenes Thema beginnen oder sachliche Fehler melden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an german@swissinfo.ch