
Die verlorene Ehre der Wasserkraft

Die Wasserkraft ist das historische Rückgrat der schweizerischen Stromversorgung. Heute, für die Energiewende, gälte das erst recht. Aber sie hat sich in den letzten Jahrzehnten ein Imageproblem eingehandelt, das sie erst wieder loswerden muss.
Schwankt der schmale Boden unter den Füssen im scharfen Wind oder sind es die Berge rundherum, die nicht stillstehen? Man ist sich auf dem Gang über die windexponierte Hängebrücke, die sich in schwindelerregenden 100 Metern Höhe über das grüne Triftwasser im Berner Oberland spannt, nie ganz sicher, was in Bewegung ist und was nicht.
Die Triftbrücke befindet sich oberhalb von Innertkirchen (BE) in einem Seitental auf 1700 Metern über Meer in einer der stillsten Berglandschaften der Schweiz. Wenn man sich getraut, mitten auf der 170 Meter langen Hängebrücke stehenzubleiben, blickt man in einen wilden, wassertriefenden Gebirgskessel, in dem weit oben die Reste des einst mächtigen Triftgletschers hängen.
Es ist ein Ort, an dem man sich viele Fragen stellen kann – weil sich hier die Konfliktdramaturgie der Wasserkraftnutzung wie in einem natürlichen Amphitheater präsentiert.
Plötzlich ein neues Becken
Die Klimaerwärmung hat den Triftgletscher, der den Kessel einst ausfüllte, rasant zurückschmelzen lassen. Die entstandene Schlucht gefährdete den Zustieg zur Trifthütte des Schweizer Alpen-Clubs, weshalb man 2005 mit der Hängebrücke Abhilfe schuf. Aber: Der Gletscherrückzug hat auch eine unberührte Gebirgslandschaft freigelegt, die Seltenheitswert hat.
Gleichzeitig weckt das zuvor nicht dagewesene Gletscherseebecken Begehrlichkeiten. Die Kraftwerke Oberhasli (KWO), das lokale Wasserkraftunternehmen, möchten die neuen natürlichen Voraussetzungen nutzen und mit einer 177 Meter hohen Staumauer einen Speichersee schaffen, der Elektrizität für rund 30 000 Haushalte liefert.

Die Dilemmata liegen übers Kreuz: Die KWO wollen Strom ohne CO2Emissionen herstellen, wie er zur Reduktion des Treibhausgasaustosses notwendig ist, opfern dafür aber unangetastete Gebirgsnatur. Deshalb blockiert eine kleine, hartnäckige Naturschutzorganisation den Stausee mit Einsprachen, nimmt aber in Kauf, dass die Schweiz zu emissionsreichen Gaskraftwerken greifen würde, um eine allfällige Stromversorgungslücke zu überbrücken.
Das wiederum gefährdet das Ziel, die Klimaerwärmung zu bremsen. Es scheint, als führe keine Argumentation aus der Sackgasse. Wie kam es so weit, dass die Wasserkraft, die einst das Sauberkeitsgütezeichen des selbsternannten Wasserschlosses Schweiz trug, um ihre Reputation als ökologische Energiequelle kämpfen muss?
Die Frage, ob künftig stets genügend Strom verfügbar sei, wühlt die Schweizer Öffentlichkeit zurzeit auf. Dass die Stromnachfrage weiter wächst, scheint alternativlos: Der Energiekonzern Axpo etwa rechnet mit einem Plus von 30 Prozent bis 2050.
Plausibel ist, dass die «Energiewende» – die gleichzeitige Abkehr von Atomkraft und fossilen Energieträgern – das Nachfragewachstum befeuert. Wärmepumpen statt Ölfeuerungen beim Heizen, E-Mobile statt Benzinautos im Verkehr bedeuten: Weniger CO2-Ausstoss, aber mehr Stromverbrauch. Wie weit Effizienzgewinne oder Verhaltensänderungen die Nachfrage dämpfen, ist schwer abzuschätzen.
Eine neue Studie aus dem Bundesamt für Energie zeigt, dass ab 2025 im Winter kurzzeitige Stromversorgungslücken drohen, weil die Nachfrage nach Strom das Angebot übersteigt. Mit seinem Entscheid, die Verhandlungen über ein Rahmenabkommen mit der EU abzubrechen, spitzt der Bundesrat die Situation weiter zu. Die EU lehnt als Folge davon das bereits ausgehandelte Stromabkommen ab, was es der Schweiz – Stand heute – erschweren wird, sich notfallmässig auf dem europäischen Strommarkt einzudecken.
Treibstoff der Hochkonjunktur
Weil der Schweiz Kohle als Energiequelle fehlte, gehörte die Wasserkraft stets zur energiewirtschaftlichen Grundausstattung. Richtig in die DNA des Landes sickerte die Wasserkraft aber in der Hochkonjunkturphase nach dem Zweiten Weltkrieg ein. In frenetischem Tempo möblierte man die Alpentäler mit gewaltigen Staumauern, und die mit den Speicherseen geschaffene stabile Stromversorgung wurde zum Rückgrat des Wirtschaftswachstums.
Die alpine Schweiz bewahrte sich mit kühnen Bauwerken im unwegsamen Berggebiet ein Stück energetische Unabhängigkeit. Tatsächlich stammten 1970, bevor die ersten Atomkraftwerke ans Netz gingen, rund 90 Prozent des Schweizer Stroms aus Wasserkraft. Es gehörte im Boomgefühl der 1970er-Jahre zum Repertoire von Familienausflügen, im Auto Richtung Wallis zu fahren, nach Sion zum Beispiel und dann hoch ins Val d’Hérémence zur überwältigenden Talsperre der Grande Dixence.
Man stand mit mulmigem Gefühl am Fuss der 285 Meter messenden Mauer, noch heute das höchste Bauwerk der Schweiz. Sie wiegt unvorstellbare 15 Millionen Tonnen, mehr als die Pyramiden von Cheops, und allein mit dem Gewicht ihres Betonbauchs hält sie den kilometerlangen See zurück. Was, wenn etwas bricht?

Befeuert wurde die Ehrfurcht vor der Wasserkraft durch illustre Ingenieure, die den Staumauerbau als Hochleistungsdisziplin betrieben. Der Tessiner Giovanni Lombardi etwa – Vater des Mitte-Politikers Filippo Lombardi, der unter anderem Präsident der Auslandschweizer-Organisation ist – machte sich 1965 einen Namen mit dem elegant gebogenen Verzasca-Staudamm, der wegen seinem schlanken Design Standards setzte.
Als James Bond in der Eröffnungsszene des 1995 veröffentlichten Films «Goldeneye» am Bungy-Seil über die Talsperre in die Tiefe sprang, wurde die Mauer zur Action-Ikone. Lombardi, der später den Gotthardstrassentunnel baute, blieb bis zu seinem Tod 2017 eine Referenzfigur für spektakuläre Bauwerke.
Wasserzins als nationaler Kitt
Eher unbemerkt festigte die Wasserkraft neben dem Heimatmythos auch den nationalen Zusammenhalt. Denn: Für das gestaute Wasser fliesst ziemlich viel Geld zurück in die Berge. Die Standortgemeinden der Kraftwerke werden für die Nutzung ihrer Ressource mit Wasserzinsen entschädigt – insgesamt mit rund einer halben Milliarde Franken pro Jahr.
Man kann Wasserzinsen als Transferzahlungen verstehen aus dem wirtschaftsstarken Mittelland ins Berggebiet, das in seine Infrastruktur investieren und der Abwanderung entgegenwirken kann. Wie eng die Wasserkraft die Schweiz über den Stadt-Land-Graben verschränkt, zeigt sich exemplarisch im Bündner Bergell: Die Elektrizitätswerke Zürich, die in den 1950er-Jahren den Albigna-Staudamm bauten, sind bis heute einer der grössten Arbeitgeber im Tal.

Mehr
Eine riesige Wasserbatterie in den Schweizer Alpen
Heftige Abwehrreflexe
Gelegentlich geht ob der mythischen Überhöhung der Wasserkraft jedoch vergessen, dass ihr Ausbau schon früh heftige Abwehrreflexe auslöste. Legendär ist das Bündner Dorf Marmorera, das sich 1954 erst nach mehreren Enteignungsverfahren dem Untergang im gleichnamigen Stausee fügte.
Bereits ab 1920 kursierten Pläne, das gesamte Urner Urserental in einem Stausee zu versenken. Nach dem Zweiten Weltkrieg, als das Projekt wegen Versorgungsengpässen vorangetrieben wurde, kam es in Andermatt zu einem gewalttätigen Volksaufstand, der das Ende des Vorhabens beschleunigte.
«AKW-Filialen in den Alpen»
Wenn man verstehen will, warum die Wasserkraft ihren Nimbus einbüsste, ist jedoch 1986 das Schlüsseljahr. Nach jahrelangem Ringen beerdigten die Kraftwerke Nordwestschweiz ihren Plan, die Greina-Ebene zwischen Graubünden und Tessin zu fluten und als Speichersee zu nutzen. Eine Koalition von wachstumskritischen Natur- und Landschaftsschützern aus der ganzen Schweiz mit der lokalen Opposition hatte die abgelegene Hochebene auf die Traktandenliste der nationalen Politik gebracht.

Die Greina wurde zum Symbol für ökologische Grundsatzkritik am Profitkreislauf der Wasserkraft, die eine Liaison mit der umstrittenen Kernenergie eingegangen war. Das kritisierte Prinzip funktioniert so: Günstiger, in Randzeiten nicht benötigter Atomstrom wird benutzt, Wasser hoch in die Speicherseen zu pumpen.
Die Kraftwerkbetreiber können so während Nachfragespitzen hochpreisigen Strom herstellen und maximieren ihren Gewinn. Legitimieren diese profitorientierten «AKW-Filialen in den Alpen», wie Kritiker zuspitzen, die Preisgabe der letzten natürlichen Gebirgs- und Flusslandschaften?
Grenzen des Wachstums?
An dieser existenziellen Frage reiben sich Befürworter und Gegnerinnen des Wasserkraftausbaus seit über 30 Jahren. Mitunter, wie beim vorerst gescheiterten Versuch, die Mauer des Grimselstausees zu erhöhen, führt die Auseinandersetzung bis vor Bundesgericht.
95 Prozent des nutzbaren Wasserkraftpotenzials werden laut der Umweltorganisation WWF in der Schweiz heute bereits genutzt. Obschon der Bund der Wasserwirtschaft schärfere ökologische Auflagen in Form von Restwassermengen macht, hält der WWF die Belastungsgrenzen für «längst überschritten»: 60 Prozent der einheimischen Fisch- und Krebsarten seien ausgestorben oder vom Aussterben bedroht.

Trotzdem sind Hunderte Aus- und Neubauten oft kleiner Wasserkraftwerke geplant. Das grösste und deshalb am heftigsten debattierte von ihnen soll im neuerdings freigelegten Vorfeld des geschrumpften Triftgletschers entstehen.
Erhöhter Leistungsdruck
Im Vergleich zur Greina-Epoche hat sich die Konfliktsituation weiter verschärft. Zwei neue Problemfelder sind hinzugekommen. Erstens: Klimaerwärmung und Gletscherschmelze führen dazu, dass sich die höchsten Wasserabflüsse jahreszeitlich vom Sommer in Richtung Frühjahr verschieben.
Zweitens: Der nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima gefällte politische Entscheid der Schweiz, die Atomkraftwerke sukzessive abzustellen, sie mit erneuerbaren Energiequellen zu ersetzen und damit das Netto-Null-Ziel beim Treibhausgasaustoss zu stützen, erhöht den Leistungsdruck auf die Wasserkraft.
Ist es überhaupt möglich, der Wasserkraft, die zurzeit knapp 60 Prozent der schweizerischen Stromproduktion sicherstellt, noch mehr abzugewinnen, ohne die ökologischen Minimalansprüche zu verraten? «Grundsätzlich ja», sagt Rolf Weingartner, emeritierter Professor für Hydrologie an der Universität Bern. Er zerlegt das Problem in seine Einzelteile und fügt diese neu zusammen, um die emotionale Auseinandersetzung nüchtern zu fassen.
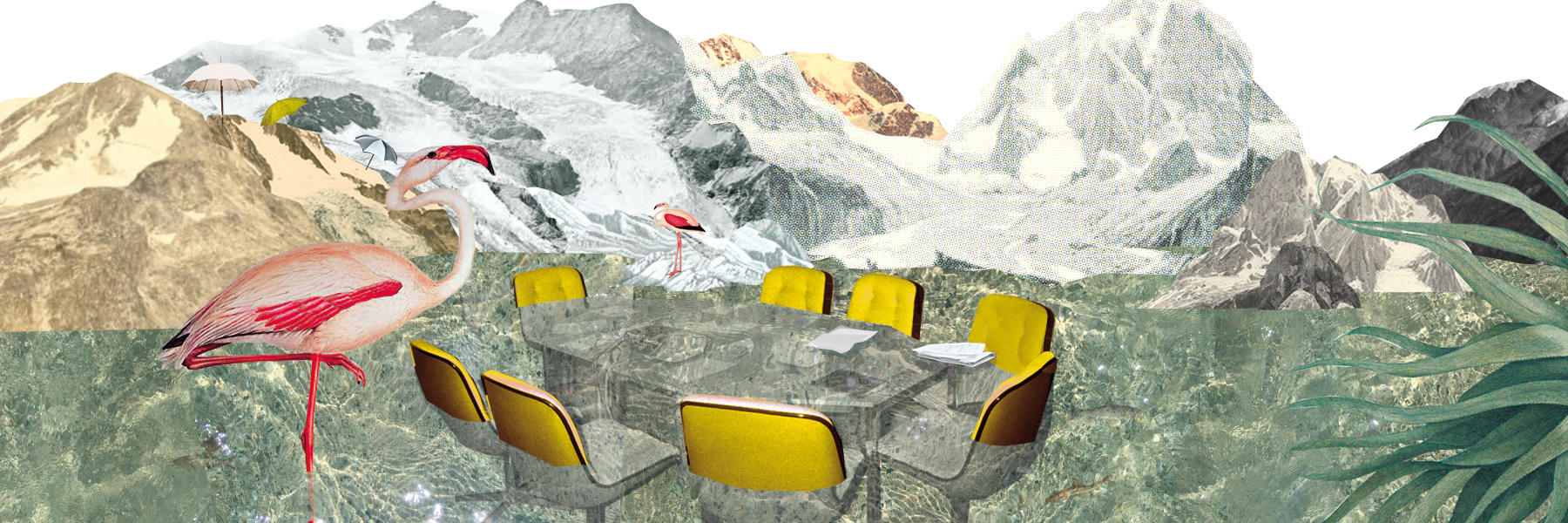
Mehr
Warum die Gletscherschmelze uns alle betrifft
Wasserkraft als neuer Service public?
Da die Wasserkraft praktisch CO2-frei Energie produziere, bleibe sie als zentrale Stromquelle vor allem im Winter, wenn etwa die Solarstromanlagen weniger produktiv sind, unabdingbar, damit Versorgungsengpässe verhindert werden. Gleichzeitig rücke die Klimaerwärmung die Bedeutung der Stauseen in ein neues Licht, erläutert Weingartner.
Denn: Hydrologisch bedeute das Abschmelzen der Gletscher, dass Wasserspeicher, die vor allem im Sommerhalbjahr für hohe Abflüsse gesorgt haben, künftig fehlen. Die Folge: Es wird im Sommer zu Wasserengpässen kommen.
Insgesamt stehen zwar in Zukunft über das Jahr gesehen immer noch ähnlich grosse Wasserabflussmengen wie heute zur Verfügung. Weil jedoch die Gletscher als Speicher wegfallen und auch der Einfluss der Schneeschmelze abnehme, verteilen sich die Abflüsse ungünstiger übers Jahr.
«Das heisst» , folgert Weingartner, «wir müssen in den Alpen die natürlichen Speicher mit künstlichen ersetzen.» Mit andern Worten gesagt: Die bestehenden Speicherseen der Kraftwerkunternehmen erhalten eine zusätzliche Funktion für das nachhaltige Wassermanagement in Zeiten des Klimawandels, indem sie in den heissen und trockenen Sommermonaten etwa die landwirtschaftliche Bewässerung alimentieren.

Mehr
Eine leistungsfähigere «elektrische Batterie» ohne Gletscher
Abgesehen davon werden an Staumauern, wie etwa am Muttsee im Glarnerland, mitunter grosse Fotovoltaikanlagen installiert, die ganzjährig Strom produzieren, weil sie über der Nebelgrenze liegen.
Angesichts dieser neu entdeckten Multifunktionalität sieht Rolf Weingartner die Wasserkraft «letztlich als Service public für die Energieerzeugung, aber auch für die nachhaltige Deckung des Wasserbedarfs, zu der auch ökologisch vertretbare Restwassermengen gehören.» So gesehen sei es eine unproduktive Routineübung, die Auseinandersetzung zwischen ökologischen und ökonomischen Interessen an jedem einzelnen Stauseeprojekt einzeln durchzuexerzieren.
Er plädiert deshalb für einen neuen, ganzheitlichen Zugang, der sich auch darum aufdränge, weil die Klimaerwärmung dazu führt, dass in den alpinen Gebieten im Zuge des Gletscherrückgangs über 1000 neue Seen entstehen, die wasserwirtschaftliches Potenzial haben.
«Wir sollten uns dazu durchringen, sogenannte Vorranggebiete zu bestimmen», sagt Weingartner. Also den Alpenraum unter Führung des Bundes in unterschiedliche Zonen zu gliedern, in denen je die Energieproduktion, die Ökologie, der Tourismus oder die Landwirtschaft den Vorrang haben. Damit würde man die Interessen räumlich entflechten und Konflikte präventiv entschärfen.
Rolf Weingartner ist sich bewusst, dass seine wasserwirtschaftliche Befriedungs-Vision in der schweizerischen Realpolitik einen schweren Stand hat. Vorerst. Solange die Schweiz allerdings ein Land bleibt, dessen Stromverbrauch unaufhaltsam steigt, müsste sie eigentlich darauf einsteigen.
*Jürg Steiner ist freier Mitarbeiter bei der Schweizer RevueExterner Link, wo dieser Beitrag zuerst erschien.

In Übereinstimmung mit den JTI-Standards

























Einen Überblick über die laufenden Debatten mit unseren Journalisten finden Sie hier. Machen Sie mit!
Wenn Sie eine Debatte über ein in diesem Artikel angesprochenes Thema beginnen oder sachliche Fehler melden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an german@swissinfo.ch