«Wir konnten uns das nicht vorstellen»

Der Schweizer Automobilingenieur Marc Besch war Teil jener Gruppe, die als erste auffälliges Verhalten bei VW-Dieselmotoren gemessen hat. Dass ein Hersteller absichtlich das Messverfahren betrügt und Gesetze bricht, hielt er zuerst nicht für möglich.
Bieler Tagblatt: Marc Besch, sind Sie ein Nerd?
Marc Besch: (lacht) Vermutlich schon ein bisschen.
Der «Spiegel» hat Sie so beschrieben.
M.B.: Es ist schon so: In praktisch jeder Diskussion, die wir unter Kollegen haben, geht es um die Arbeit.
Sind Sie ein dermassen leidenschaftlicher Abgastechniker?
M.B.: Ich bin Forscher, habe eine grosse Faszination für die Technik. Ich mag es, auch selber mal was zu tun, nicht nur die Theorie anzuschauen. Ich lebe nun seit zehn Jahren auf dem Campus, mittlerweile zwar als Assistenzprofessor, doch ich verbringe jeden Tag mit den Studenten.
Sie sind einer der drei Forscher, der den wohl grössten deutschen Industrieskandal der Nachkriegszeit aufgedeckt hat. Sie kommen gerade von einem Kongress in Berlin – wie reagierten die Leute dort auf Sie?
M.B.: Konferenzen sind sehr expertenlastig. In solchen Kreisen kennt man unser Institut ohnehin. Da steht die Qualität der Arbeit und der Forschung im Mittelpunkt, das Medieninteresse ist da weniger wichtig. Aber man erkennt mich nun leichter, kommt auf mich zu, fragt etwas.

Erzählen Sie, wie Sie dem Diesel-Skandal auf die Spur gekommen sind.
M.B.: Am Anfang stand ein ausgeschriebener Forschungsauftrag. Ausgangslage war die Tatsache, dass die Stickoxidemissionen in europäischen Städten höher waren, als es die Modellrechnungen vorhergesagt hatten. Es war erwartet worden, dass diese mit den strengeren Abgasnormen sinken würden, doch dem war nicht so.
Das warf Fragen auf: In den USA waren die gleichen Dieselfahrzeuge auf dem Markt, aber dort hatten sie noch strengere Normen zu erfüllen. Die Grundidee war also, in den USA zu schauen, wie die Dieselautos sauber sein können.
Es war dann nicht ganz einfach, der Forschungsetat wurde gekürzt.
M.B.: Ja, am Schluss hatten wir nur noch knapp 70’000 Dollar zur Verfügung. Das ist wenig, wenn man Fahrzeuge ausführlich auf der Strasse testen will. Wir haben zudem den Versuch nach Kalifornien verlegt, weil dort mehr Dieselfahrzeuge in Betrieb sind und wir unser mobiles Labor bereits dort stationiert hatten.
Es ist ja auch noch schön, dem Pazifik entlangzufahren.
M.B.: Allerdings. Es war Februar, in West Virginia war’s kalt und es hatte Schnee, in Kalifornien war’s warm und sonnig. Das war nicht übel.
Die Messungen waren offenbar nicht ganz einfach, Sie mussten basteln und improvisieren.
M.B.: Unsere Instrumente sind für Lastwagen-Applikationen entwickelt worden, wir mussten sie in einem VW Jetta und dem Passat unterbringen. Wir mussten einen Generator integrieren. Dessen Abgase leiteten wir zwar mit Schläuchen nach draussen, aber der Generator ist laut, gibt Wärme ab, ein Kompressor lief noch… Wir haben probiert, mit dem Radio das Ganze zu übertonen, aber es war schon laut.
Bieler Tagblatt: Das klingt nicht nach gemütlichem Cruisen und Roadmovie-Romantik.
M.B.: Es war natürlich spannend, das alles zu tun, aber nach ein paar Stunden in all dem Lärm hatte man auch mal genug.
Was ging Ihnen durch den Kopf, als Sie die ersten Messresultate sahen?
M.B.: Wir kannten die Technologie bereits von der Arbeit mit Lastwagen. Wir wussten: Wenn der Motor eine gewisse Temperatur hat, wird die Technologie aktiviert und man sollte eine signifikante Änderung sehen in der Abgaskonzentration, zum Beispiel, wenn man vom Stadtverkehr auf die Autobahn wechselt. Und diese Änderung stellten wir nicht fest.
Da fragten wir uns: Was haben wir falsch gemacht? Haben wir die Messgeräte nicht richtig kalibriert? Wir haben alles überprüft und mit den Laborgeräten verglichen. Unsere Geräte funktionierten aber richtig, also musste der Fehler woanders liegen.
Die Schadstoffwerte waren bis um das 35-fache höher als vom Hersteller angegeben. Haben Sie da keinen Verdacht geschöpft?
M.B.: Man muss sehen: Wir haben nur zwei Fahrzeuge mit zwei unterschiedlichen Technologien getestet. Statistisch gesehen konnte dies also auch ein Zufallsresultat sein. Im Labor haben die Autos aber so funktioniert, wie sie sollten. Wir dachten also an ein technisches Problem. Diese Systeme sind recht kompliziert, es braucht viel Kalibrierung, es hätte also sein können, dass dabei etwas falsch gelaufen ist.
Es fällt auf, dass Sie in Ihrem Abschlussbericht die Ergebnisse nur beschrieben, aber nicht kommentiert oder interpretiert haben.
M.B.: Wir wussten bloss, dass irgendwas nicht so war, wie es sein sollte, aber die Ursache dafür zu untersuchen war nicht Bestandteil des Forschungsauftrags. Wir fanden keine anderen Studien, die unsere Ergebnisse gestützt oder erklärt hätten.
Also muss man vom wissenschaftlichen Standpunkt aus schon vorsichtig sein in seinen Schlussfolgerungen. Weitergehende Aussagen wären bloss Vermutungen gewesen, nicht wissenschaftlich fundierte Befunde.
Haben Sie denn nicht gedacht, es könnte sich um Betrug handeln?
M.B.: Unter uns haben wir ab und zu gewitzelt, dass es sich um Vorsatz handeln könnte. Doch es gab in den USA 1998 einen ähnlichen Fall bei Lastwagen, die dank einer Software auf dem Prüfstand bessere Abgaswerte zeigten als im Strassenbetrieb. Diese Hersteller wurden dann ziemlich hart rangenommen. Wir konnten uns also nicht ernsthaft vorstellen, dass der grösste Autohersteller der Welt so etwas absichtlich tun würde.

Die kalifornische Aufsichtsbehörde ist aber durchaus hellhörig geworden, nachdem Sie Ihre Ergebnisse vorgestellt hatten.
M.B.: Wir haben uns schon während des Projekts mit ihr ausgetauscht. Unser Bericht gab ihr den Ausschlag, aktiv zu werden. Die Behörde hatte die Mittel dazu, eine breite Untersuchung durchzuführen.
Wann haben Sie schliesslich erfahren, worum es wirklich ging?
M.B.: Wir haben im Januar 2015 von einem Rückruf gewisser Fahrzeuge durch Volkswagen vernommen, da dachten wir, unsere Arbeit habe offenbar geholfen, ein technisches Problem zu identifizieren. Am 15. September 2015 erfuhren wir dann den wirklichen Grund über die Medien.
Was ging Ihnen da durch den Kopf?
M.B.: Ich fühlte Bedauern. Deutsche Ingenieurstechnologie wurde auch in den USA bis zu diesem Zeitpunkt sehr geschätzt. Ich hätte nie gedacht, dass deutsche Ingenieure zu solchen Mitteln greifen würden, um ihre Produkte auf den Markt zu bringen.
Ich habe Kollegen, die als Ingenieure bei GM arbeiten. Das Management hatte hohen Druck auf sie ausgeübt, auch solche Produkte auf den Markt zu bringen, doch sie schafften es trotz grosser Efforts nicht, auf die Emissionswerte von Volkswagen zu kommen.
Es ist also schade, dass jemand eine Abkürzung nimmt, um wirtschaftliche Vorteile zu haben. Die Technologie an sich ist nämlich gut, das haben wir bei den Lastwagen gesehen.
Volkswagen hat bis jetzt 25 Milliarden Euro für die Folgen des Betrugs aufgewendet, es befinden sich Personen in Haft. Der Volkswagen-Konzern dürfte Ihnen wohl nicht so rasch ein Jobangebot unterbreiten.
M.B.: Vermutlich niemandem aus unserer Gruppe. Wobei es ja auch Software-Firmen gibt, die Hacker anstellen.
Volkswagen hatte eine beträchtliche kriminelle Energie entwickelt. In Europa gibt es jährlich 4500 vorzeitige Todesfälle durch Schadstoffemissionen. Wenn ein Auto das 35-fache des Erlaubten ausstösst, geht es schlicht um Menschenleben.
M.B.: Das stimmt. Aber in der längerfristigen Betrachtung gilt es auch zu relativieren. Die tatsächlichen absoluten heutigen Emissionswerte sind immer noch geringer als jene vor zehn Jahren, es fand also durchaus Fortschritt statt.
Aber die vorsätzliche Manipulation der Emissionswerte im Wissen um die Folgen für die Umwelt und die Menschen und der bewusste Verstoss gegen Gesetze, das ist in der Tat kriminell.
Muss man sich die Autobranche vorstellen wie den Radsport in den 1990er-Jahren – getrickst wird überall?
M.B.: Die Branche ist extrem kompetitiv, an allen Enden geht es um Kosteneinsparungen. Es ist kein Geheimnis, dass Hersteller versuchen, Spielräume auszuloten. Man kann auch festhalten, dass der Gesetzgeber nicht verstanden hat, wie die neuen Technologien wirklich funktionieren und es darum unterlassen hat, effektiv wirksame Kontrollregeln zu definieren.
Erst der Dieselskandal zeigte die Dringlichkeit auf. Seit dem 1. September 2017 müssen Fahrzeuge in Europa nun auch auf der Strasse zertifiziert werden, nicht nur auf dem Prüfstand.
Wenn Sie so aufs Ingenieurs-Ethos pochen: Wie erklären Sie es sich, dass es bei VW überhaupt so weit kommen konnte? Es haben ja nicht nur einzelne vom Betrug gewusst.
M.B.: Darüber habe ich oft nachgedacht. Ein Jurist sagte mir in einem Gespräch: Die Antwort, wie es dazu kommen konnte, wird man bei den Buchhaltern finden. Ich vermute, das zu erwartende Risiko und der zu erwartende Gewinn wurden berechnet und abgewogen. Letztlich hat aber jeder Beteiligte seine eigene Geschichte, hat vielleicht Druck erlebt und eine Familie zu ernähren.
Braucht es Standesregeln für Ingenieure, die besagen, dass man seine Kompetenzen nicht zum Betrügen verwenden soll?
M.B.: Das wurde mir beim Abschluss des Studiums in Biel mitgegeben: Ich solle meine Arbeit nicht dafür einsetzen, Menschen zu schaden oder beispielsweise Waffen zu entwickeln. Grundethos des Ingenieurs sollte es sein, Dinge zu verbessern.
Ihr Institutsleiter, Dan Carter, wurde vom «Time»-Magazin 2016 zu einer der 100 einflussreichsten Persönlichkeiten der Welt gekürt. Das hat er auch Ihnen zu verdanken, nicht?
M.B.: Wir haben dies durchaus als Anerkennung für die ganze Gruppe verstanden. Unser Team funktioniert wie eine Familie. Wenn wir nicht gerade zusammen arbeiten, verbringen wir die Freizeit zusammen. Wir gehen nach Feierabend nicht sofort nach Hause, sondern trinken was und diskutieren Resultate.
Die deutsche Autobranche ist am kürzlichen Dieselgipfel glimpflich davongekommen, statt einer kostspieligen Umrüstung der Autos muss sie nur ein Software-Update vornehmen. Wie ist das zu bewerten?
M.B.: Mit der Software-Umrüstung lassen sich in Europa die Grenzwerte offenbar einhalten. In den USA dagegen wird ein Teil der Fahrzeuge nicht mehr auf dem Markt zugelassen, weil sie technologisch die geforderten Werte gar nicht erreichen können. Andere Fahrzeugkategorien müssen umgerüstet werden. Die finale Lösung ist aber noch nicht festgelegt. Für VW ist die Sache noch nicht ausgestanden.
Jedenfalls gewinnt man den Eindruck, die Politik in Deutschland gehe zu pfleglich um mit VW. Es besteht eine bemerkenswerte Verbandelung, da lässt sich auch mal ein Ministerpräsident eine Rede von VW umschreiben. Wie bewerten Sie diese Verhältnisse?
M.B.: Es ist sicherlich besser, wenn Gesetzgeber, Kontrollinstanz und Hersteller deutlich genug voneinander abgetrennt sind. Das gilt für jedes System.
Wie sehen Sie die Zukunft des Dieselmotors?
M.B.: Im Transportsektor wird der Dieselmotor für absehbare Zukunft weiterhin die wichtigste Antriebstechnologie sein. Es ist noch kein ökonomisch sinnvoller Ersatz absehbar. Bei den leichteren Personenwagen wird der Diesel höchstwahrscheinlich verschwinden. Die Kosten für die geforderte weitere Reduktion der Abgaswerte sind zu hoch.

Sie selber fahren einen alten Jeep, habe ich gelesen.
M.B.: Nein. Es ist ein neuer. Ich habe ihn aus Interesse an der Technologie gekauft.
Das lässt sich leicht sagen.
M.B.: (lacht) Ich habe schon gerne Autos.
Es ist sicherlich ein grosses Auto.
M.B.: Ja – für US-Verhältnisse aber nicht einmal so sehr. Mein Kaufinteresse war wirklich die Technologie, der Wagen hat jene Abgastechnologie, an der ich meine Forschungsarbeit ausrichte.
Ein E-Auto zu fahren reizt Sie nicht?
M.B.: Es gibt zweifellos Anwendungsgebiete, für die der Elektromotor sehr Sinn macht. Das Problem ist, dass wohl kaum jemand bereit ist, gewohnten Komfort preiszugeben, etwa was das rasche Tanken betrifft.
Grundsätzlich ist für mich ein Fahrzeug aber dazu da, von A nach B zu gelangen, mit der höchstmöglichen Effizienz und mit möglichst wenig Beeinträchtigung für Umwelt und Mensch. Es soll sich jene Technologie durchsetzen, die dies am besten leisten kann.
In dieser Haltung unterscheiden Sie sich von einigen Leuten in Ihrer Umgebung in West Virginia – es gilt dort als Volkshobby, bei Pick-ups alle Filter auszubauen und dann an Kreuzungen Velofahrer und Fussgänger einzunebeln. Man kann sich schwerlich vorstellen, dass an einem solchen Ort die Zukunft entwickelt wird.
M.B.: Ich rege mich selber darüber auf, wenn ich das sehe. Es ist ungesund, und warum man jemandem schadet, der einem nichts zuleide getan hat, das verstehe ich nicht. Doch unser Institut ist sehr renommiert für angewandte Emissionsmessungen.
Wie sehen Sie Ihre Zukunft?
M.B.: Mir gefällt das universitäre Umfeld sehr, ich kann Forschung betreiben, bin freier, flexibler. Mir gefällt die Arbeit mit den Studenten, sie kommen aus aller Welt, ich lerne immer wieder dazu. Karrieretechnisch gesehen wäre es aber nicht schlecht, auch mal Industrieerfahrung zu sammeln.
Ist eine Rückkehr in die Schweiz denkbar?
M.B.: Ursprünglich wollte ich nur für das zweijährige Masterstudium in die USA gehen, mittlerweile sind daraus zehn Jahre geworden. Irgendwann möchte ich aber schon wieder nach Europa oder in die Schweiz zurückkehren, zumal man die kleine Universitätsstadt Morgantown auch mal gesehen hat.
Ihr Heimweh scheint sich aber in Grenzen zu halten.
M.B.: Das ist so, yeah.

In Übereinstimmung mit den JTI-Standards

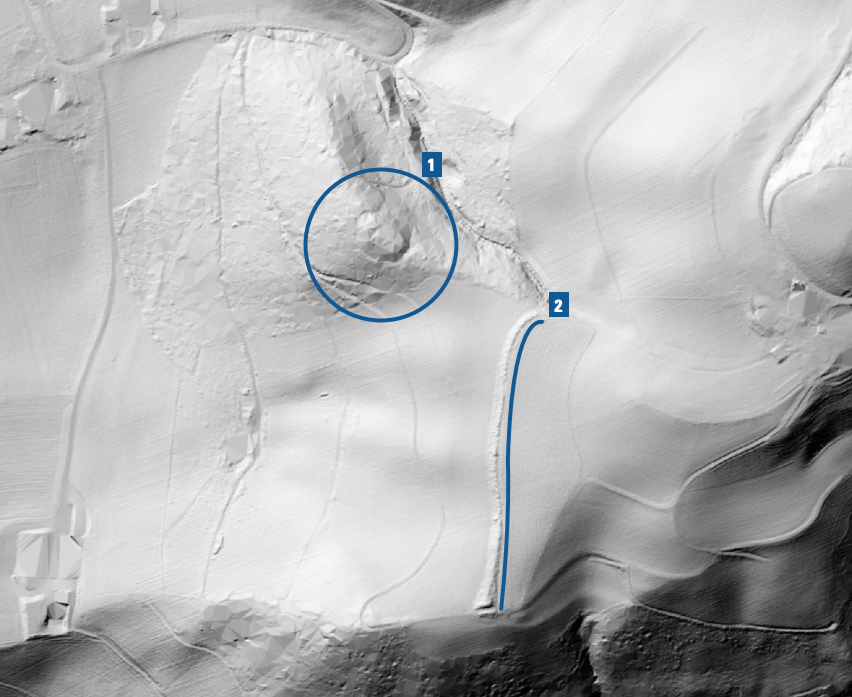











Einen Überblick über die laufenden Debatten mit unseren Journalisten finden Sie hier. Machen Sie mit!
Wenn Sie eine Debatte über ein in diesem Artikel angesprochenes Thema beginnen oder sachliche Fehler melden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an german@swissinfo.ch