Schmutziges Geld sauber zurückgeben – aber wie?

Um zu verhindern, dass Potentatengeld wieder in der Korruption versickert, zahlt die Schweiz die Mittel über Entwicklungsprojekte an betroffene Länder zurück. Dieser Paternalismus kommt nicht nur gut an.
Die Schweiz galt lange als Hort für Potentaten- und Korruptionsgelder. Dieses Image will sie abschütteln. Sie geht dabei weiter als jedes andere Land weltweit: Sie leistet spontane Rechtshilfe, meldet sich also bei Verdacht auf Korruptionsgelder bei einem betroffenen Staat, ohne ein Rechtshilfegesuch abzuwarten.
Und sie hat eine Lösung für die Rückzahlung von Potentatengeldern gefunden, wenn ein Rechtshilfeverfahren gescheitert ist oder wenn in einem Failed State zu erwarten ist, dass die Gelder wieder in der Korruption versickern: Die Gelder werden über die Finanzierung von «Programmen von öffentlichem InteresseExterner Link» rückerstattet.
Weltweit führen erst wenige Länder Potentatengelder auf diese Weise zurück. Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) weiss von den USA, den UK und Jersey, deren Restitutionen eine entwicklungspolitische Komponente aufweisen. Gretta FennerExterner Link, Direktorin des International Centre for Asset Recovery am Basel Institute on Governance, das auf die Rückführung illegal erworbener Vermögenswerte spezialisiert ist, bilanziert: «Wenn Gelder gefunden werden, dann leistet die Schweiz sehr effektiv, kreativ und progressiv Hilfe.»
Ein «paternalistischer» Ansatz
Doch diese «kreative Hilfe» stösst bei den betroffenen Ländern nicht nur auf Begeisterung. Denn anstatt die Gelder einfach in die Steuerkasse zu überweisen, will die Schweiz bei der Verwendung mitreden. Ja, nicht nur das: Wie der Fall Kasachstan aus dem Jahre 2007 zeigt, will die Schweiz mit der Rückführung der Gelder sogar Entwicklungsziele erreichen.
Das Modell Kasachstan
2007 verhandelten die Schweiz, die USA und Kasachstan unter Einbezug der Weltbank eine neuartige Lösung bei der Rückzahlung von Bestechungsgeldern an Kasachstan: Es wurde eine kasachische Stiftung gegründet, die mit den rückerstatteten Geldern arme Familien unterstützte. Die Weltbank übernahm das Monitoring.
Zwar konnten mit dem Geld die Lebensbedingungen einiger kasachischer Familien verbessert werden, doch die Schweiz war dennoch nicht zufrieden. Laut EDA hätte die Rückzahlung auch noch «entwicklungsrelevant» sein sollen, wie der Journalist und Korruptionsexperte Balz Bruppacher in seinem Buch «Die Schatzkammer der DiktatorenExterner Link» nachzeichnet. Immerhin: «International stiess das Modell Kasachstan auf grosse Anerkennung», so Bruppacher.
«Selbstverständlich gehört das Geld dem Staat, in den es zurückgeführt werden sollte», sagt Fenner. Aber wenn der betroffene Staat es mit der Korruptionsbekämpfung ernst meine, dann sei es in seinem Interesse, dass das Geld strategisch eingesetzt und dessen Verwendung engmaschig verfolgt werde.
Die NGO Public Eye begrüsst die Rückerstattung über konkrete Projekte statt der allgemeinen Steuerkasse. «Es ist zwar ein etwas paternalistischer Ansatz, jedoch kann so am ehesten sichergestellt werden, dass die Bevölkerung als Ganzes von der Rückgabe profitiert», schreibt Oliver Classen von Public Eye.
Mehr
Der Journalist und Korruptionsexperte Balz Bruppacher versteht die Sorge der Schweiz über erneute Korruption, aber auch den Ärger der betroffenen Länder über die Einmischung: «Der Vorwurf, die Schweiz habe ihnen das Geld weggenommen und wolle ihnen nun auch noch vorschreiben, was sie damit machen sollten, ist nicht ganz von der Hand zu weisen», sagt er. Deswegen lege die Schweiz aber grosses Gewicht auf das Mitspracherecht der betroffenen Länder. «Verhandlungen sind wichtig», so Bruppacher. Und: «Gar nichts zu machen, wäre meiner Meinung nach auch keine Lösung.»
Mangelnde Transparenz? Das Beispiel Peru
Zur Regelung der Rückerstattung kann der Bundesrat gemäss GesetzExterner Link ein Abkommen mit dem betreffenden Staat abschliessen. So geschehen beispielsweise im Falle von Korruptionsgeldern des ehemaligen peruanischen Geheimdienstchefs Vladimiro Montesinos: Vergangenen Dezember unterzeichnete die Schweiz mit Peru und Luxemburg ein trilaterales RestitutionsabkommenExterner Link. 16,3 Millionen US-Dollar von Schweizer Konten sollen in peruanische Projekte zur Stärkung der Rechtsstaatlichkeit und der Korruptionsbekämpfung investiert werden.
Laut Gretta Fenner vom International Centre for Asset Recovery werden solche Rückführungsabkommen meist ohne grosse Publizität verhandelt. Zwar poche die Zivilgesellschaft darauf, ebenfalls am Verhandlungstisch zu sitzen. «Aber das kann ich in diesem Fall nicht befürworten.» Um gute Ziele zu erreichen, sei eine gewisse Geheimhaltung notwendig. Hingegen sollten laut Fenner nach Verhandlungsabschluss die Resultate im Detail bekanntgegeben werden, damit die Zivilgesellschaft ihre Kontrollfunktion wahrnehmen könne.
Korruptionsexperte Balz Bruppacher findet Transparenz wichtig, nur so könne man auch die Schweizer Bevölkerung überzeugen: «Wenn der Eindruck entsteht, es werde unter der Hand gemischelt, dann sind Abkommen politisch umstritten.»
Der Peru-Kenner und Journalist Alex Baur, dessen Recherchen massgeblich zur Repatriierung von Geldern aus dem Montesinos-Korruptionsskandal beigetragen haben, ist hingegen grundsätzlich skeptisch gegenüber dieser Form der Rückzahlung: «Wir sollten uns keine Illusionen machen. Wenn die Schweiz mit beschlagnahmten Korruptionsgeldern Bäumchen setzt oder ein paar Windräder baut in Entwicklungsländern, so tut sie das nur, damit wir uns selber besser fühlen; den betroffenen Ländern bringt das rein gar nichts.»
Laut Baur ist Bestechung in Lateinamerika auf staatlicher Ebene leider nicht die Ausnahme, sondern eher die Regel: «Das einzige, was in Lateinamerika noch korrupter ist als die Politik, ist die Justiz.» Die Justiz sei die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln, sprich: Ein Strafverfahren wegen Korruption gegen Politiker einzuleiten, sei ein gängiges Mittel, um politische Gegner auszuschalten.
Tragischerweise sei die Justiz damit zur grössten Bedrohung für den Rechtsstaat geworden, den sie an sich verteidigen müsste. Und dagegen könnten wir nicht viel tun: «Wir haben eine andere Kultur und wollen ihnen beibringen, wie man es aus unserer Perspektive richtig macht, das ist gewissermassen eine Fortsetzung des Kolonialismus.»
Es gibt einen Vorschlag – unter anderem vom ehemaligen Chef der Rechtshilfe im Bundesamt für Justiz –, der die Schweiz aus dieser problematischen Rolle befreien würde: Die Schaffung eines internationalen Fonds. Dieser könnte beispielsweise bei der Uno oder der Weltbank angesiedelt sein. «Dieser Fonds würde entscheiden, wie das Geld zurückgeführt wird, was die Schweiz entlasten würde», sagt Bruppacher. Allerdings zeige das Beispiel der Weltbank, dass es auch bei internationalen Organisationen nicht automatisch besser laufe.

In Übereinstimmung mit den JTI-Standards




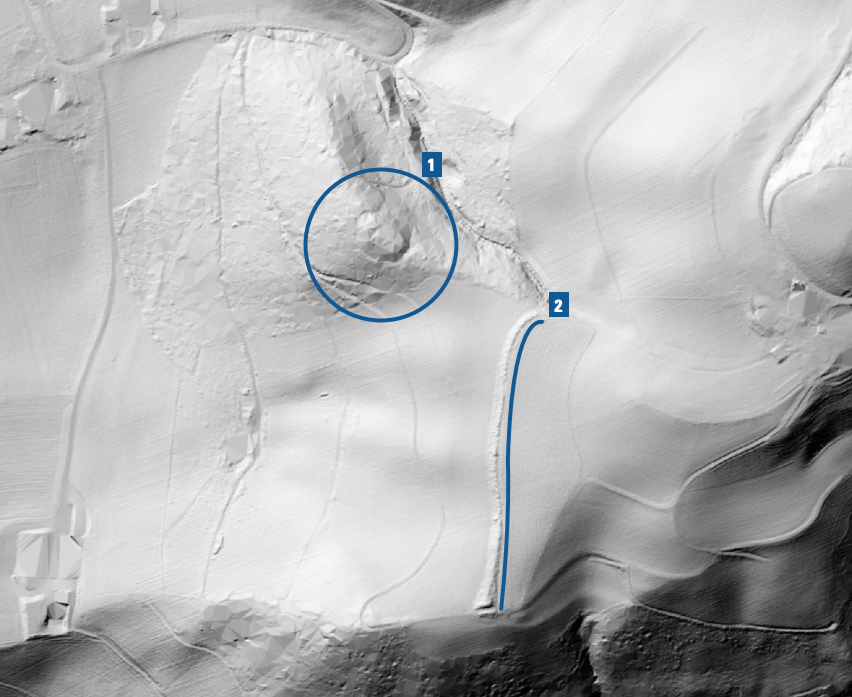











Diskutieren Sie mit!