Beim Hausbau ist die Schweiz Meisterin des langwierigen Planens

Die Schweiz hat Planungsprozesse bei grösseren Bauprojekten professionalisiert – nicht zuletzt wegen der direkten Demokratie. Partizipation aber bedeuten oft Verzögerung und höhere Kosten. Zürcher Raumplanungs-Profis geben Auskunft.
Die Schweiz kennt eine Besonderheit: die direkte Demokratie. Bürger und Bürgerinnen können über Sachthemen abstimmen. So auch über grössere Bauprojekte oder Nutzungspläne, also die Aufteilung eines Gebiets in Bauzonen, Freiräume, Landwirtschaftsland oder Industriegebiete.
Es kann vorkommen, dass jahrelang an einem Bauvorhaben geplant wird, mit Architekturwettbewerben, detaillierten Projekten und komplizierten Gestaltungsplänen (siehe Box). Und am Schluss sagen Parlament oder Bevölkerung: Nein, das wollen wir nicht. Die Kosten für die jahrelange Planung können sich die Bauherren dann ans Bein streichen.
Ein Gestaltungsplan ist ein Rechtsinstrument, mit dem von einer Bau- und Zonenordnung abgewichen werden kann. Der Bauherr macht der Stadt oder Gemeinde einen detaillierten Vorschlag für die Überbauung eines Gebiets und kann dabei von der eigentlichen Zonenordnung abweichen, sofern er im Gegenzug etwas bietet. Zum Beispiel kann er von der Ausnutzungsziffer oder der vorgeschriebenen Höhe der Gebäude abweichen, wenn er dafür ein überzeugendes Energiekonzept, mehr Bäume oder preisgünstigen Wohnraum vorsieht. Es ist eine Art Austauschhandel, der vom Parlament praktiziert wird. Während der Private seine Ziele verwirklichen kann, profitiert die Öffentlichkeit ebenfalls. Gelebte «direkte Demokratie» also auch beim Planen und Bauen.
Bauen ist in der Schweiz also ein anspruchsvolles, kostspieliges und manchmal auch riskantes Vorhaben. Deshalb gibt es professionelle Raumplanungsbüros, die Bauherren durch den ganzen Prozess begleiten. Insbesondere versuchen sie, die Bevölkerung und andere betroffene Parteien früh miteinzubeziehen, um die Akzeptanz für das Projekt zu erhöhen und damit einen Schiffbruch an den Urnen zu verhindern.
In einer Serie gehen wir aktuellen raumplanerischen Fragen in der Schweiz nach. Folgende Themen sind unter anderem geplant:
«Die Schweiz ist Vorreiterin bei der Partizipation, diesbezüglich könnten unsere Planungen andere Länder durchaus inspirieren», sagt Martin Vinzens, Chef der Sektion Siedlung und Landschaft beim Bundesamt für Raumentwicklung.
Doch wie funktioniert das konkret? Wir haben ein Zürcher Raumplanungsbüro gefragt, das uns anhand eines konkreten Projekts Schritt für Schritt zeigt, wie ein solcher Planungsprozess abläuft.
So läuft ein Planungsprozess in der Schweiz ab
Im Jahr 2014 wurde direkt beim Bahnhof Zürich ein bisher von der Bahn genutztes Grundstück für eine neue Überbauung frei. Die Eigentümerin, die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB), beauftragten das Zürcher Raumplanungsbüro Planwerkstadt AGExterner Link mit der Verfahrensbegleitung.
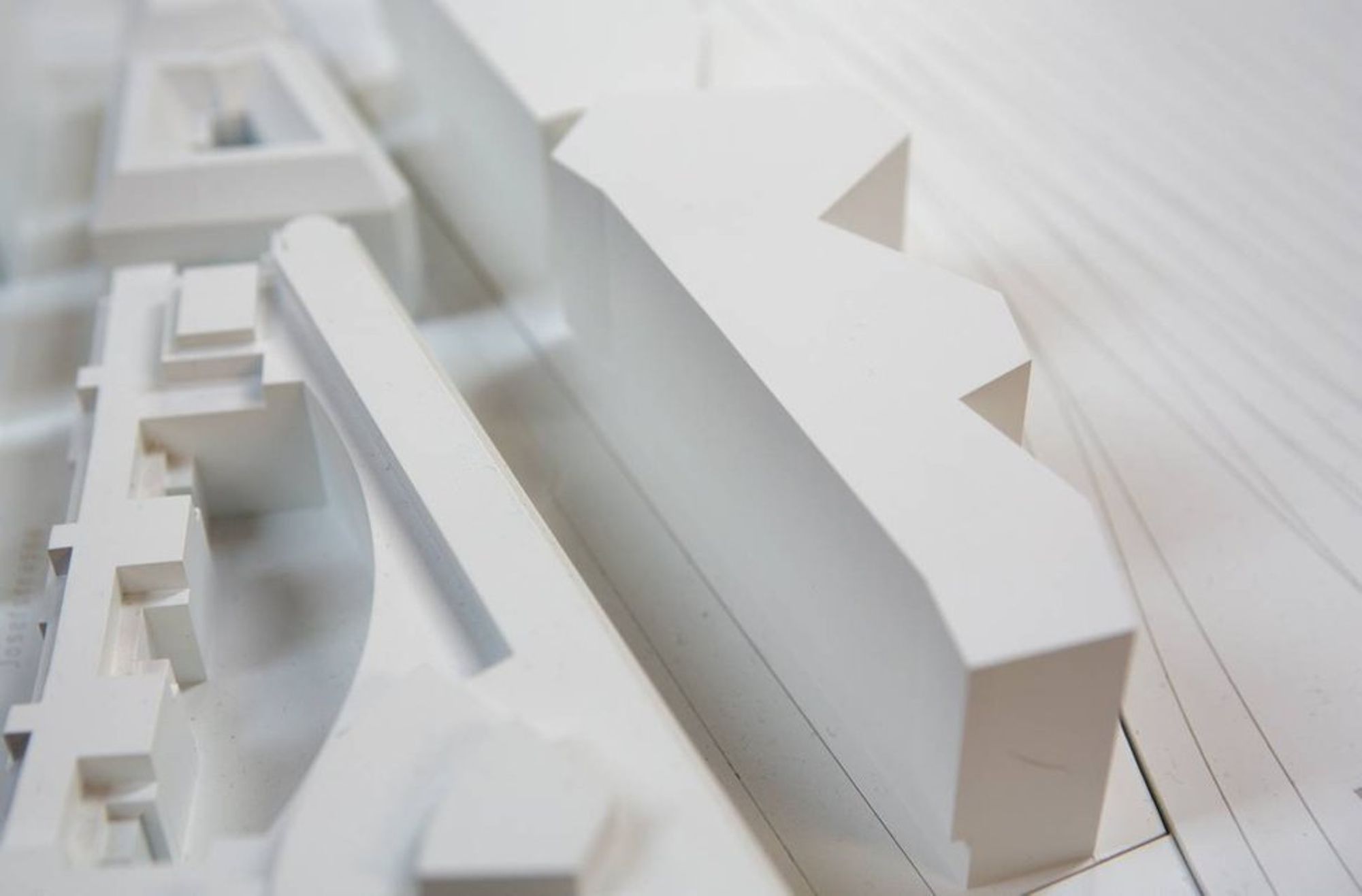
Schritt 1: Nutzungsworkshops
In SBB-internen Workshops wurde eruiert, wofür das Gelände genutzt werden soll und welcher Mehrwert daraus für das Quartier resultiert. Die SBB favorisierten eine Mischnutzung: Es sollten Wohnungen gebaut werden, aber auch Läden und Restaurants im Erdgeschoss Platz finden. Die SBB stellten sich vor allem die Frage: Was macht Sinn und ist ökonomisch?
«Heute würde man diese Workshops vielleicht öffentlich durchführen und die Bevölkerung mitmachen lassen», sagt Dieter Zumsteg, Gründer des Raumplanungsbüros Planwerkstadt. «Es ist ein Trend, Bevölkerung und Stakeholder aktiv einzubinden, das war vor 20 Jahren noch nicht Usus.»
Schritt 2: Programm für Studienauftrag
Als Nächstes entwickelte das Raumplanungsbüro ein Programm für einen Studienauftrag. Hier konnte sich die Bevölkerung an einem offenen Workshop einbringen. Das war wichtig, denn zu dieser Zeit begannen die Zürcherinnen und Zürcher Druck auf die SBB Immobilien aufzusetzen, mit dem Projekt nicht übermässig Geld einzukassieren, sondern auch etwas für die Allgemeinheit zu tun – auf der anderen Seite der Geleise war kurz zuvor mit der umstrittenen «Europa-Allee» ein kommerzielles Projekt entstanden.

Mehr
Europaallee – Zürichs umstrittener Stadtteil
«Es ist wichtig, diese Workshops gut zu organisieren und kein reines Brainstorming ohne Einfluss auf die Planung zu machen. Ein Jekami ist nicht sinnvoll», sagt Zumsteg zu diesem Schritt. «Aber für die Akzeptanz ist es wichtig, dass die Bevölkerung ihre Meinung sagen und Ideen einbringen kann.» Diese gelte es dann, in den Planungsprozess aufzunehmen.
Die Bevölkerung habe darüber diskutieren können, ob vor allem Single-Wohnungen, Familienwohnungen, Miet- oder Eigentumswohnungen gebaut werden sollen. «Das haben sie schon geschätzt», meint Zumsteg. Schnell war klar: Es werden nur Mietwohnungen gebaut und sie dürfen nicht zu teuer sein. Auch den Erdgeschossen galt eine besondere Aufmerksamkeit. «Diese müssen einen Mehrwert für das angrenzende Quartier bringen, also Läden und Gastroangebote bieten», rekapituliert Zumsteg.
Schritt 3: Ausschreibung Studienauftrag
Mehrere Architekturbüros reichten im Rahmen eines Studienauftrags Beiträge ein, in denen sie die Dichte und die städtebauliche Figur der geplanten Überbauung skizzierten: Wie viel Dichte verträgt es, wo braucht es Freiräume?
«Die Leute vom Quartier konnten bei den Zwischenkritiken dabei sein, das ist schon eher ungewöhnlich», so Zumsteg. Normalerweise sei nur die Fachwelt dabei. Zwei Vertreter der Quartiersbevölkerung konnten mitentscheiden, welcher der Vorschläge favorisiert wird.
Auch die Stadt sei stark eingebunden gewesen, so Zumsteg, denn diese musste später ja den Gestaltungsplan genehmigen (aber dazu kommen wir später).

Schritt 4: Ausstellung des städtebaulichen Konzepts
Die von drei Architekturbüros eingereichten städtebaulichen Konzepte mit Bildern und Entwürfen wurden in einer Ausstellung präsentiert. Das Raumplanungsbüro organisierte auch eine Vernissage, wo wiederum die Öffentlichkeit anwesend sein durfte. Schliesslich einigte sich die Bauleitung auf eine Lösung.
Schritt 5: Privater Gestaltungsplan
Das Gewinner-Architekturbüro überarbeitete seinen Vorschlag nochmals dahingehend, dass er als Basis für einen privaten Gestaltungsplan diente, der daraufhin bei der Stadt eingereicht werden konnte (siehe Box).

Der Gestaltungsplan musste nun vom Stadtparlament beschlossen werden. «Wir als Raumplanungsbüro wissen, was die öffentliche Hand verlangt und beraten die Bauherren, was sie im Gegenzug bieten sollen», so Zumsteg. Das erhöht die Chancen, dass der Gestaltungsplan von der Stadt beschlossen und schliesslich vom Kanton genehmigt wird.
Aber auch wenn das Parlament einverstanden ist, besteht die Gefahr, dass jemand das Referendum ergreift und die Sache vors Volk kommt. In kleineren Gemeinden kommt der Gestaltungsplan sowieso direkt vors Volk – nämlich an die Gemeindeversammlung.
«Wenn der Gestaltungsplan nicht durchkommt, war die ganze Vorarbeit für die Katz», sagt Zumsteg. «Es kommt vor, dass trotz massiver Einbindung der Bevölkerung an der Gemeindeversammlung 50 Nasen aus manchmal unerfindlichen und oft sehr emotionalen Gründen sagen: ‹Nein, das wollen wir nicht.› Für den Bauherren ist das natürlich ein Frust, denn er hatte enorme Kosten», erzählt Zumsteg.
Im konkreten Fall ging alles gut: Das Projekt wurde durchgewunken.
Schritt 6: Architektur-Wettbewerbe
Als Nächstes schrieb das Raumplanungsbüro Architekturwettbewerbe aus. Jetzt ging es nämlich um die konkreten Gebäude. Zuvor war es lediglich um das Volumen, die Dichte und die Nutzung gegangen.
Je acht Architekturbüros nahmen an zwei Wettbewerben teil. Die beiden Gewinner dürfen bauen. Die anderen haben Pech gehabt, der Aufwand geht auf eigene Kosten. «Es ist ein grosser Aufwand, der den Büros hier Flöten geht», räumt Zumsteg ein. «Aber wenn ein Architekturbüro alle paar Jahre einen grösseren Wettbewerb gewinnt, lohnt es sich trotzdem.»
Schritt 7: Juryberichte und Ausstellung
Nun wurden mehrere Tage für die Jurierung investiert, an denen die Vorschläge minutiös durchdiskutiert wurden. In einem Jurybericht wurde dargelegt, aus welchen Gründen man sich für das Siegerprojekt entschieden hat. Abschluss bildete eine Ausstellung aller Projektvorschläge. Wiederum ein Anlass für alle interessierten Kreise aus der Bevölkerung.
Dann begann das grosse Bauen – doch das ist eine andere Geschichte, in die das Raumplanungsbüro nicht involviert ist.
Inzwischen sind die Gebäude fertiggestellt, Mieter, Läden und Restaurants eingezogen. «Die Wohnungen waren sehr begehrt», erzählt Zumsteg. «Es ist ja auch eine Hammerlage: Direkt am Zürcher Hauptbahnhof mit freiem Blick über das Gleismeer, fast wie an einem Seeufer.»
Serie Raumplanung
In einer Serie gehen wir aktuellen raumplanerischen Fragen in der Schweiz nach, hier die anderen Beiträge:

Mehr
Wie das Schweizer Mittelland langsam zu einer einzigen Agglomeration wird

Mehr
Enger bauen heisst nicht schlechter leben

Mehr
Warum in der Schweiz kaum in die Höhe gebaut wird

Mehr
«Future Cities»: Was die Schweiz von Singapur lernen kann

Mehr
Wer von der Schweizer Raumplanung profitiert, und wer verliert

Mehr
Bauboom ausserhalb der Bauzone – wie geht das in der Schweiz?

In Übereinstimmung mit den JTI-Standards















Einen Überblick über die laufenden Debatten mit unseren Journalisten finden Sie hier. Machen Sie mit!
Wenn Sie eine Debatte über ein in diesem Artikel angesprochenes Thema beginnen oder sachliche Fehler melden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an german@swissinfo.ch