Schwierige Heirat von «Swiss Made» mit «Made in China»

Europa ist ein immer attraktiverer Teich für Investoren aus China mit voller Portokasse. Schweizer Firmen haben besondere Anziehungskraft. Bereits rund 70 Unternehmen, darunter Syngenta, Mercuria und Swissport, haben in chinesischen Besitz gewechselt. Dies sorgt in der Schweizer Wirtschaft teils für Unruhe. Aber auch in China.
Wirtschaftsexperten wiederholen stets: Übernahmen sind eine zweigleisige Sache. Die Welle der japanischen Übernahmen von Schweizer Firmen in den 1970er- und 1980er-Jahren hinterliess eine Spur der Vernichtung, überlebten doch nur rund 10% der übernommenen Schweizer Unternehmen. Seither reagieren Schweizer Inhaber vorsichtiger, wenn ausländische Investoren vor der Türe stehen.
Industrie-Insider sehen für den jüngsten Syngenta-Handwechsel zu ChemChina dasselbe Szenario, wie es für das israelische Unternehmen Makhteshim Agan eintraf, nachdem der chinesische Staatskonzern 60% des grössten Herstellers von Nachahmer-Pestiziden geschluckt hatte: 2014 wurde die Firma in ADAMA Agricultural Solutions Ltd. umbenannt.
In einigen Fällen aber ermöglichte der Zukauf einer ausländischen Firma dem neuen chinesischen Eigner, dass er die eigene Bürokratie umgehen konnte.
Nepotismus vs. Dynamik
Innerhalb chinesischer Unternehmen, insbesondere Staatskonzernen, herrsche oft Günstlingswirtschaft, sagt Guanglian Pang, Direktor des Verbandes der chinesischen Öl- und Chemieindustrie. Dies bedinge einen Strategiewechsel zwischen der Entwicklungs- und der Umsetzungsphase am Markt.
«Tatsächlich sind die komplexen zwischenmenschlichen Beziehungen und der langwierige Entscheidungsprozesse die wichtigsten Gründe für einen Gang ins Ausland», sagt er.
Aber Staatskonzerne hätten die Fähigkeit, sich rasch anzupassen. Dies wegen der häufigen Wechsel in den Führungsetagen. Frische Leute wollten auch frischen Wind hineintragen statt den Status Quo zu übernehmen, denn so können sie sich laut Guanglian Pang einen Namen verschaffen.
Viele Führungsmandate sind auf 10 Jahre limitiert. Aber chinesische Manager ziehen meist schon nach fünf Jahren weiter. Auch darum sind Langfrist-Strategien schwer umsetzbar. Hier könnte der Syngenta-Deal ein Zeichen setzen: Er steht für die Ambition und die Strategie von ChemChina-Boss Jianxin Ren. Aber ob die Übernahme so über die Bühne geht, wie er sich das vorstellt, ist alles andere als klar, geht er doch 2018 in Rente.
«Swiss Made» oder «Made in China»?
Andere Frage: Wie hat das Herkunftssiegel nach einer chinesischen Übernahme auszusehen? Für viele steht «Swiss Made» für hervorragende Qualität und hohe Preise, während es bei «Made in China» gerade umgekehrt ist: niedrige Qualität zu Tiefpreisen.
Nach einer Übernahme meiden die neuen chinesischen Besitzer meist jeglichen Kontakt zu Medien, ob aus der Schweiz oder aus China. Die Absicht dahinter: die Swissness unangetastet lassen, und damit die Konnotation mit hoher Qualität.
«Swiss Made» ist nicht nur bei chinesischen Bossen, sondern gerade auch bei den Konsumenten hoch im Kurs. Auch darum ist der neue Eigner nicht daran interessiert, die Zelte in der Schweiz abzubrechen und die Produktion nach China zu verlagern.
Etwas anders sieht es im Bereich Forschung und Entwicklung aus. Schweizer Unternehmen wie etwa die Pharmariesen Novartis und Roche haben Forschungszentren in China eröffnet. Dies nicht nur aus Kostengründen, sondern auch, um die Bedürfnisse und Gewohnheiten der lokalen Konsumenten besser kennenzulernen.
Schweizer Kultur missachtet
Chinesische Übernahmen verfolgen zuweilen das «Eisberg-Modell»: Die Schweizer Tochter markiert das eine Prozent, das an der Spitze sichtbar bleibt und das Image prägt. Unter dieser zur Schau gestellten Oberfläche aber operieren die chinesischen Eignerfirmen oft so, dass es zu Konflikten mit der traditionellen Firmenkultur des Schweizer Tochterunternehmens kommt. Was sich schlecht auswirkt auf die Loyalität der Mitarbeiter und das Vertrauen der Kunden.
Boomende chinesische Investments
Laut einer Studie von Ende Januar erreichten chinesische Investitionen 2015 die Rekordmarke von 67,4 Mrd. Dollar, 40% mehr als im Vorjahr.
Die Firmenkäufe wurden v. a. in den USA und Europa getätigt.
Im laufenden Jahr geht der deutsche Maschinenbauer KraussMaffei an die China National Chemical Corp (ChemChina). Diese wird auch den Schweizer Agrochemie-Hersteller Syngenta übernehmen. Der Kaufpreis von 43 Mrd. Franken Kaufpreis ist chinesischer Rekord.
Auch jagen die Eigner aus Fernost mit der Expansion gutausgebildeten Schweizer Nachwuchs oder gar Schweizer Geschäftsgeheimnisse, was dem Ruf und Vertrauen ebenfalls abträglich ist, wie Juan Wu sagt. Sie ist Spezialistin für internationale Geschäftsbeziehungen am Institut für angewandte Wissenschaften der Universität Zürich.
«Einige chinesische Firmen bringen viele schlechte Gewohnheiten in die Schweiz mit», sagt sie. «Dies verursacht schwere Schäden und hat eine grosse Auswirkung auf die soziale Kultur, welche die Schweizer auf der Basis von Loyalität und Vertrauen in Jahrhunderten aufgebaut haben.» Solche Unterschiede könnten aber im voneinander Lernen ausgeglichen werden.
Ungeliebte Chefs
Geht es schief, schieben beide Seiten, Chinesen wie Schweizer, die Schuld «kulturellen Unterschieden» zu. Aber gemäss Guanglian Pang liegen die Gründe im Fall von Problemen eher im chinesischen Management.
Übernähmen US-Firmen bei Schweizer Unternehmen das Ruder, so Juan Wu, komme es oft zu Massenentlassungen, und die Führung werde auf den Kopf gestellt. Chinesen dagegen würden die Beibehaltung der Integration der Schweizer Tochter vorziehen.
Dies sei aber noch kein Grund, dass es mit der Zusammenarbeit klappe. Denn wie ihre Forschungen seit dem Jahr 2012 zeigen, beklagen sich die meisten Schweizer Führungskräfte über den Stil des chinesischen Managements.
Wie sie aus Gesprächen mit Schweizer Kader weiss, kommen besonders Herumkommandieren der Untergebenen und öffentliche Kritik an diesen gar nicht gut an. Ebenso wenig die Betonung der Hierarchie, Kontrolle via Mikro-Management sowie Machtdemonstrationen. Schweizer dagegen seien eher gewohnt an Autonomie, Diskretion und Privatsphäre.
Ein Finanzchef einer Schweizer Firma habe ihr geklagt, dass er sich nicht mit dem «paternalistischen Management-Stil» der neuen Führung habe anfreunden können, die sich zudem stets in Mandarin unterhalten würden. «Der chinesische CEO schien wie vor 2000 Jahren zu leben, weil er sich als König sah», zitiert die Forscherin den Interviewten.
Ein Grund, wieso Bosse chinesischer Staatsunternehmen keine so gute Laune verbreiten, könnte der Monatslohn sein. Dieser ist von der Regierung fixiert und kann auch mal 1200 Franken sein, was in der Schweiz praktisch einem Lehrlingslohn entspricht. Immerhin gäbe es Kompensationen für die Wohn- und Lebensmittelkosten, betont Guanglian Pang.
«Diese riesigen Lohndifferenzen erwecken bei chinesischen CEOs den Eindruck, dass sie ein Niemand sind. Also führen sie ihre Angestellten sehr eng und wollen so zeigen, dass sie doch jemand sind.»
(Übersetzt und adaptiert von Juan Zhao und John Heilprin)

In Übereinstimmung mit den JTI-Standards










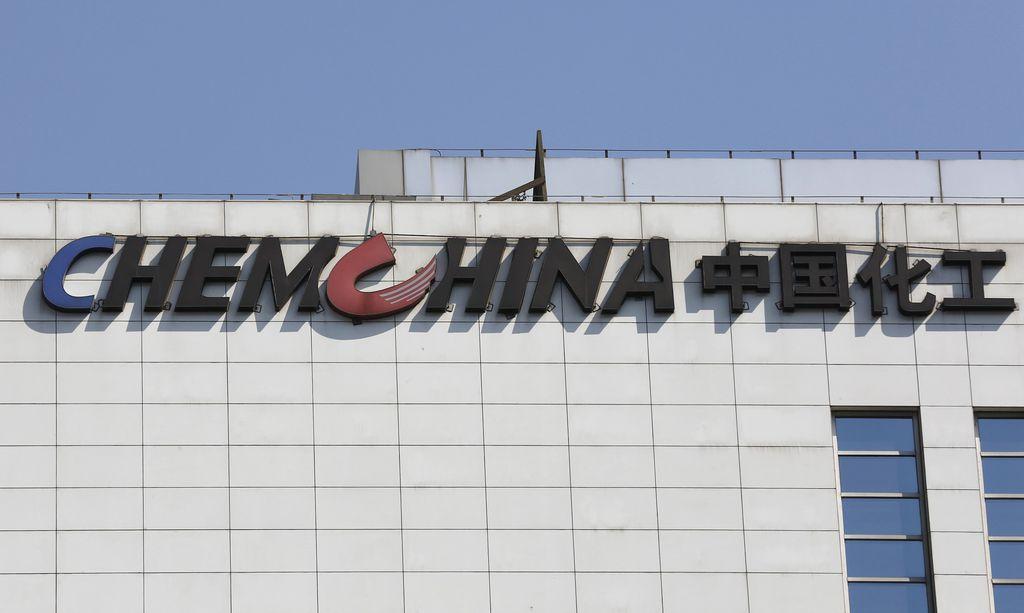




Einen Überblick über die laufenden Debatten mit unseren Journalisten finden Sie hier. Machen Sie mit!
Wenn Sie eine Debatte über ein in diesem Artikel angesprochenes Thema beginnen oder sachliche Fehler melden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an german@swissinfo.ch