Zwischen Spezialisierung und Herausforderungen
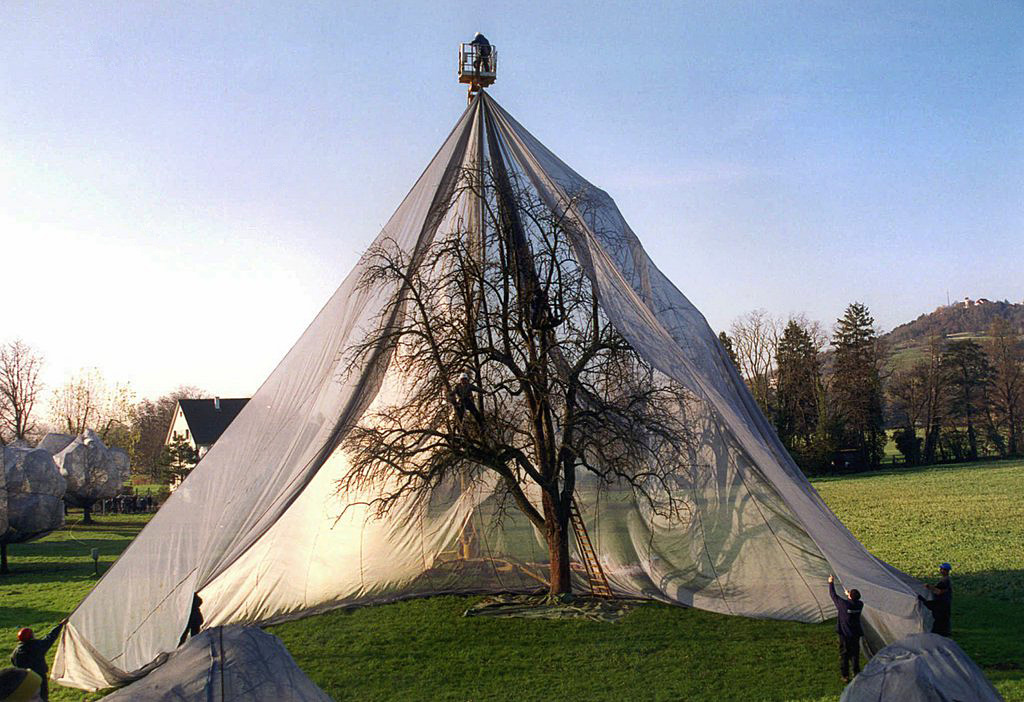
Joghurts sehen alle gleich aus. Es ist die Verpackung, die den Unterschied macht. In der Schweiz scheint die Verpackungs-Industrie die Krise gut gemeistert zu haben. Doch Bauchschmerzen machen der Branche immer noch Druckrückstände im Karton, die Lebensmittel verunreinigen können.
Sei es im Discount-Shop, in der Luxus-Confiserie oder im Hochregallager eines Möbelhändlers: Die Verpackung eines Produkts ist in den letzten Jahren immer wichtiger geworden. Sie schützt ein Produkt, ist Werbe- und Informationsfläche.
Die Verpackungs-Industrie der Schweiz erwirtschaftet rund 1 Prozent des jährlichen Bruttoinland-Produkts (BIP) des Landes (siehe Kasten). «Das ist im Verhältnis zu anderen Ländern deutlich höher», sagt Stephan Schüle, Geschäftsführer des International Packaging Institute in Schaffhausen, das die Industrie weltweit beobachtet. Zu den grossen im Geschäft gehören in der Schweiz die Model-Gruppe, die Westschweizer Bourquin oder SIG in Schaffhausen, um nur einige zu nennen.
Dass ausgerechnet die Schweiz im Bereich der Verpackungs-Technologie eine wichtige Rolle spiele, habe einen geschichtlichen Hintergrund, so Schüle: «Vor 100 Jahren wurde in der Gegend von Schaffhausen die Aluminiumfolie erfunden. Die Schweiz ist traditionell ein Engineering-Land. Auch Verpackungs-Maschinen haben hier einen hohen Stellenwert.»
Joachim Kreuter, Chefredaktor der Branchen-Publikation Pack aktuell, pflichtet ihm bei: Häufig würden Produkte von Schweizer Verpackungs-Betrieben mit Preisen ausgezeichnet. Wie beispielsweise 2012 eine für den Flaschenhersteller Sigg aus Karton und Kunststoff entwickelte Verpackung, die sehr einfach zu öffnen und zu entsorgen ist. «Im internationalen Vergleich müssen sich die Schweizer mit ihren Verpackungs-Innovationen wirklich nicht verstecken», sagt Kreuter.

Mehr
Die Verpackung wird «intelligent»
Gesunde Industrie
Die Verpackungs-Industrie präsentiere sich gegenwärtig in einem gesunden Zustand, sind sich Branchenbeobachter einig. Dies trotz der Euro-Krise, die in den letzten Jahren für einige Probleme gesorgt hat.
Eine gewisse Krisenresistenz der Branche liegt für Schüle im Vorteil, dass sich Nahrung immer verkauft. «Auch wenn es der Wirtschaft schlecht geht, müssen sich die Leute ernähren oder brauchen Kosmetika und Pharmazeutika.»
Heute seien die Angestellten technisch immer mehr gefordert, sagt Philippe Dubois, Geschäftsführer des Schweizerischen Verpackungsinstituts (SVI). «Wir brauchen immer mehr Spezialisten, welche die verschiedenen Verpackungs-Lösungen beherrschen.»
Eine Beobachtung, die auch Schüle und Kreuter gemacht haben. «Bei den einfachen Produkten hat es die Schweizer Verpackungs-Industrie tatsächlich schwer», sagt Kreuter. Daher ist für ihn klar: «Die Betriebe müssen versuchen, sich über das Produkt, über die reine Verpackung hinaus, unentbehrlich zu machen.»
Denn das grosse Wachstum in dieser Branche finde künftig nicht in Europa statt, sagt Schüle, «sondern in Asien und in näherer Zukunft auch in Afrika. Das ist die Herausforderung». Deshalb müsse die Branche innovationsfähig bleiben und «die technische Führerschaft übernehmen», ergänzt er. «Einfache Produkte kann man überall beziehen, da gibt es viele, die günstiger sind.»
Das Schweizerische Verpackungsinstitut (SVI), der Branchenverband, der sich zu seinem 50-jährigen Bestehen ab Juni «Verband der schweizerischen Verpackungsindustrie» nennen wird, zählt rund 250 Mitglieder-Betriebe mit etwas über 19’000 Beschäftigten.
2011 erwirtschaftete die Branche einen Umsatz von rund 6,7 Mrd. Fr., fast gleich viel wie im Vorjahr.
Gemessen am schweizerischen Bruttoinland-Produkt (BIP) von 586,8 Mrd. Fr. machte dies etwa 1,15% aus.
Mit rund 3,6 Mrd. Fr. den grössten Teil des Umsatzes erwirtschaftete der Bereich Kunststoff, der Bereich Karton und Wellkarton generierte knapp 1 Mrd. Fr. Umsatz.
Im April trifft sich die Branche zur jährlichen Messe in Zürich.
Bitterer Beigeschmack
Eine weitere Herausforderung für die Verpackungs-Branche sieht Kreuter gegenwärtig in der Frage der Verunreinigung von Lebensmitteln aus Druckrückständen in Verpackungen.
Bereits seit Mitte der 1990er-Jahre ist bekannt, dass Stoffe aus Verpackungen Spuren in Lebensmitteln hinterlassen können. Meistens handelt es sich dabei um Mineralöle, Lösemittel oder Weichmacher, die aus recycelten Zeitungen und Büchern stammen, aus denen der Karton entsteht. Und immer wieder zeigen Untersuchungen, dass Verunreinigungen auch heute noch vorkommen.
«Die Schwierigkeit ist, dass man nicht alle Substanzen kennt, die aus Verpackungen migrieren können», sagt Thomas Gude. Er ist Lebensmittelchemiker und wissenschaftlicher Leiter bei Swiss Quality Testing Services, das zur Gruppe des Detailhändlers Migros gehört. Zudem habe Recycling-Karton «wechselnde Qualitäten», die mit Lebensmitteln in Kontakt kämen.
«Wenn ich ein Produkt verpacke, dann muss ich sicherstellen, dass die Verpackung das Produkt nicht negativ beeinflusst», bringt Kreuter das Problem auf den Punkt. Deshalb habe die Branche vor fünf Jahren eine «Joint Industry Group» (JIG) ins Leben gerufen, die sich mit diesem Problem beschäftige.
«Was die Schweizer Industrie anbetrifft, sind wir der Meinung, dass die Allgemeinheit ihren Job gemacht hat», sagt Philippe Dubois. «Sie kennt die Problematik seit längerer Zeit.» Die JIG habe eine Checkliste erarbeitet, um das Risiko zu vermindern. «Vermeiden kann man es nicht.»
In der Schweiz sei man in dieser Frage viel weiter als in anderen Ländern Europas, schätzt Stephan Schüle. «Die Schweiz hat in diesem Zusammenhang in den letzten Jahren eine Vorreiterrolle inne gehabt.» Eine Meinung, die auch Gude teilt. Die Schweizer Verpackungs-Industrie sei mit der JIG «sicherlich auf dem richtigen Weg», betont er.

Mehr
Bento-Boxen sind eine moderne Tradition
Eine Frage der Menge
Ob für den Menschen schädlich oder nicht, sei «definitiv» eine Frage der Menge einer Substanz, die in ein Lebensmittel migriere, sagt Chemiker Gude. Zudem gibt er zu bedenken: «Man muss sicherlich unterscheiden, ob eine Substanz in Grundnahrungsmittel übergeht, von denen ich recht viel esse, oder beispielsweise in eine Schokolade, von der ich nicht täglich esse.»
Eine Schweizer Studie hat nachgewiesen, dass auch die Umgebungstemperatur einen Einfluss darauf hat, in welchem Ausmass es zu einer Migration von Substanzen kommt.
Mittelfristig müsse ganz sicher über so genannte «funktionelle Barrieren» zwischen Verpackung und dem so genannten Packgut nachgedacht werden, ist Lebensmittelchemiker Gude überzeugt. Dabei handelt es sich meist um eine oder mehrere Schichten eines lebensmittelverträglichen Kunststoffs, die im Innern der Verpackung angebracht werden.
Auch Kreuter ist der Meinung, sollte es nicht gelingen, die Schadstoffe aus dem Recycling-Prozess herauszulösen, müssten solche Barrieren eingesetzt werden. «Das ist eine Aufgabe, die noch nicht gelöst ist.»

In Übereinstimmung mit den JTI-Standards


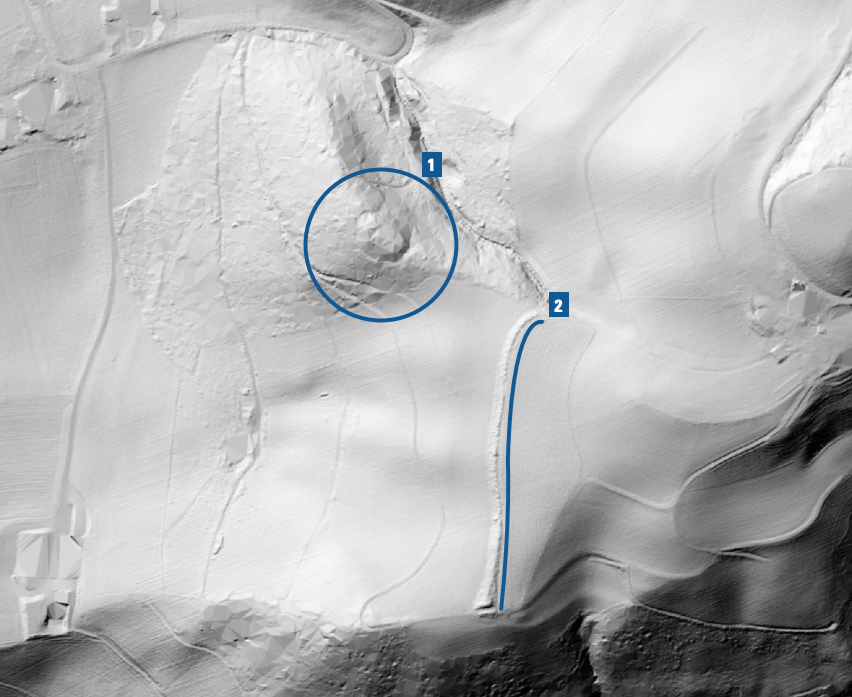







Einen Überblick über die laufenden Debatten mit unseren Journalisten finden Sie hier. Machen Sie mit!
Wenn Sie eine Debatte über ein in diesem Artikel angesprochenes Thema beginnen oder sachliche Fehler melden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an german@swissinfo.ch