Wie Entwicklungshilfe dekolonisieren?

Stimmen aus dem Globalen Süden und rechte Kreise in westlichen Ländern sind sich einig: Entwicklungshilfe ist kolonialistisch. Bei der Frage, was sich ändern muss, gehen die Meinungen aber auseinander.
Wer kennt es nicht: Auf einem Plakat oder Flyer ist ein dunkelhäutiges Kind zu sehen, dem eine Träne über die Wange kullert, darüber ein Schriftzug, der um Spenden bittet.

Für Dylan Mathews von der NGO Peace Direct, die lokale Friedensaktivist:innen direkt vor Ort unterstützt, ist das struktureller Rassismus. «Viele internationale NGOs verwenden beim Fundraising immer noch problematische Stereotypen der ‹bedürftigen› afrikanischen Kinder und erwecken damit den Eindruck, Menschen im Globalen Norden könnten jene im Süden ‹retten›.»
Peace Direct hat zusammen mit anderen NGOs aus dem Globalen Süden in einer mehrtägigen Online-Konsultation über 150 Personen aus den Bereichen Entwicklungshilfe, Friedensförderung und humanitäre Hilfe befragt und anschliessend in einem BerichtExterner Link Tipps und Empfehlungen publiziert, wie Hilfe dekolonisiert werden kann.
Denn das Plakat mit dem weinenden Kind ist nur ein Beispiel unter vielen. Autor:innen und Organisationen kritisieren generell koloniale Haltungen in der Entwicklungszusammenarbeit und der humanitären Hilfe. Laut dem schweizerischen Aussendepartement bringen einige Entwicklungsländer das Thema auch in die Debatten bei den Vereinten Nationen ein.
Die Afrikawissenschaftlerin Josephine Apraku begründet in einem Video des Solidaritätsdienstes International e. V. (SODI), warum sogenannte «Entwicklungshilfe» als Konzept in kolonialer Tradition problematisiert werden muss:
Schützenhilfe erhalten die Stimmen aus dem Globalen Süden ausgerechnet von rechten Kreisen im Westen. Laut der Nationalrätin der rechtskonservativen Schweizerischen Volkspartei (SVP) Barbara Steinemann hat Entwicklungshilfe etwas Herablassendes und Entwürdigendes. An der heutigen Entwicklungshilfe stört sie grundsätzlich: «Sie beruht auf dem Gedanken, dass ‹die da unten› es nicht allein schaffen.»
Entwicklungshilfe abschaffen?
Ginge es nach rechtskonservativen Kreisen, liesse sich das Problem einfach lösen, indem man die Entwicklungshilfe abschafft.
Auch Steinemann gibt zu bedenken, dass sich jene Länder, die keine oder wenig Hilfe vom Westen erhalten hätten – zum Beispiel Vietnam oder Südkorea – rasant entwickelt hätten. Hingegen gebe es afrikanische Staaten, die einen Grossteil ihres Haushalts aus westlicher Entwicklungshilfe finanzierten. «Diese Unsummen haben viele ihrer Ziele verfehlt», so Steinemann. «Die politischen Schlussfolgerungen wären wohl, sich aus diesen Gebieten zurückzuziehen.»
Im Globalen Süden sieht man das anders. «Die Aktivist:innen, die an unserer globalen Konsultation teilgenommen haben, fordern nicht das Ende der internationalen Zusammenarbeit», stellt Mathews klar. Vielmehr forderten sie eine Änderung von Verhalten und Einstellungen der Entwicklungshelfer:innen.
Das Schweizer Hilfswerk Caritas begründet in einem Video, warum es Entwicklungszusammenarbeit heute noch brauche:
Auch Steinemann plädiert nicht für die Abschaffung jeglicher Hilfe. Statt in Entwicklungshilfe und internationale Gremien würde sie die Mittel aber lieber in Nothilfe für Kriegsopfer sowie in Katastrophenhilfe investieren. «Wir geben leider Millionen aus für Studien, Konferenzen, Workshops, runde Tische und Mietzuschüsse an UN-Büros», klagt Steinemann. Auch fliesse zu viel Geld in Kultur und Ideologie statt in Krisengebiete. «Wir investieren in junge Theaterleute und Maler in Mali und Usbekistan oder in eine Schule für Rock-Musik in Bosnien-Herzegowina», mokiert sie sich. Ein Blick in die Projekt-Datenbank der DEZAExterner Link bestätigt, dass die Schweiz in Themen investiert, deren Beitrag an die wirtschaftliche Entwicklung eines Landes nicht direkt ersichtlich ist.

Womit wir bei der zentralen Frage sind: Wüsste die einheimische Bevölkerung nicht besser, welche Hilfe nützlich ist?
Verschiebung von Entscheidungsmacht

Laut der britisch-nigerianischen Unternehmensberaterin und Politikwissenschaftlerin Faye EkongExterner Link, die in Ghana aufgewachsen ist, lässt sich Entwicklungshilfe unter anderem dadurch dekolonisieren, indem man die Empfängerländer selbst über den Einsatz der Mittel entscheiden lässt.
Es gehe darum, sowohl das Narrativ zu ändern als auch die Macht zu verlagern. Oder bildlich ausgedrückt: «Wenn ihr in mein Haus kommt und mir helft, es neu einzurichten, dann lasst mich bitte entscheiden, wie ich es einrichten will», so Ekong. Entwicklungszusammenarbeit solle eine Partnerschaft auf Augenhöhe sein.
Bedingungslose Reparationen statt Hilfe
Laut Peace Direct fordern immer mehr Aktivist:innen, dass westliche Länder bedingungslose Reparationen für zu Kolonialzeiten begangenes Unrecht zahlen. Degan Ali von African Development Solutions ADESOExterner Link sagte in der Online-Konsultation: «Wenn wir die Finanzierung von humanitärer Hilfe und Entwicklungshilfe auf Wiedergutmachung umstellen, dann ist sie ein Recht und keine Gefälligkeit, die den lokalen Organisationen vorenthalten werden kann mit der Begründung, ihnen fehlten die Fähigkeiten.»
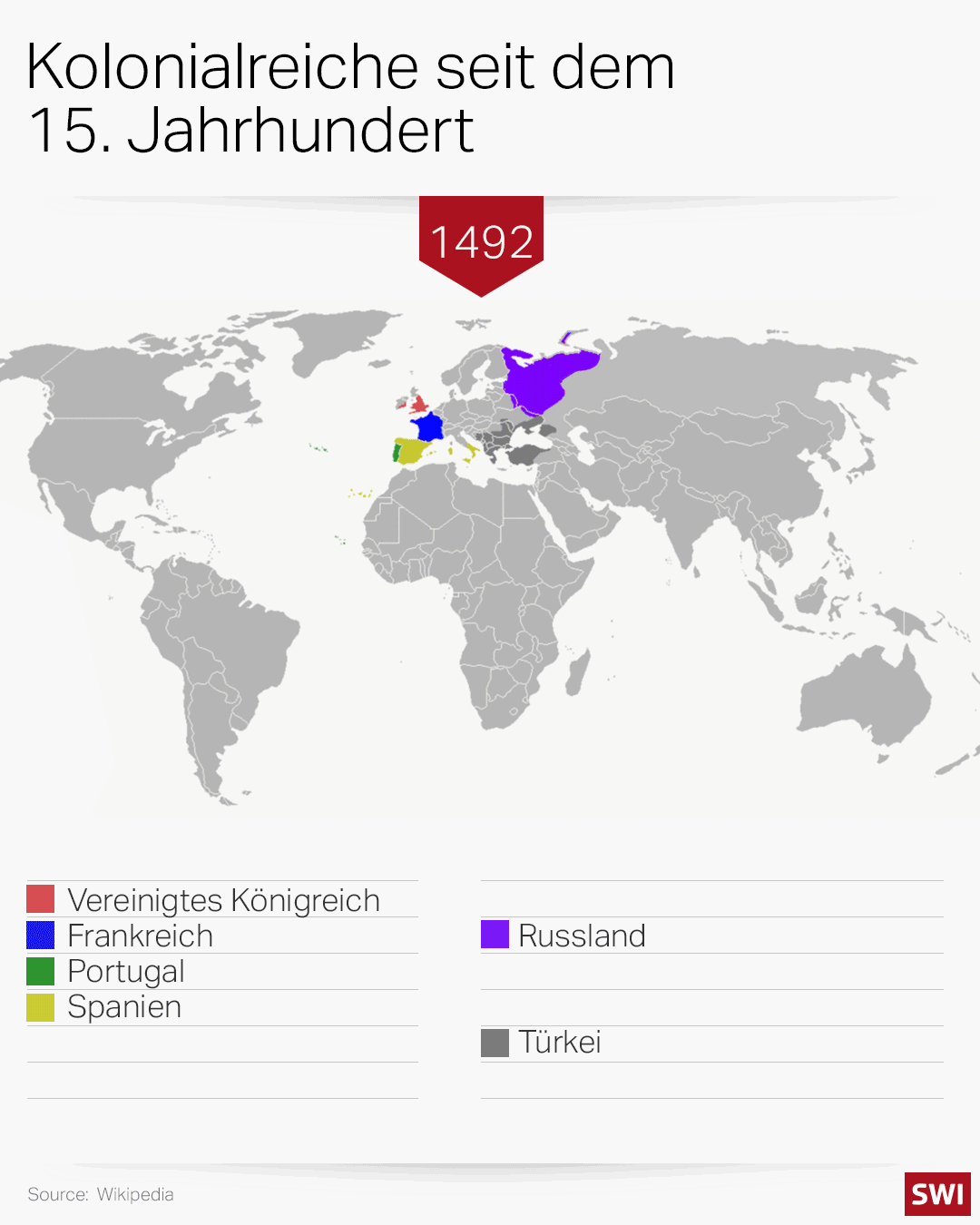
Auch der Mosambikaner Elisio Macamo, Professor für Soziologie mit Schwerpunkt Afrika an der Universität Basel, ist für Rückzahlungen.
Er veranschaulicht es anhand einer kleinen Geschichte: «Stellen Sie sich eine Familie vor mit einem Vater, der zu viel trinkt und sich nicht um die Kinder kümmert. Eines Tages taucht ein Einbrecher auf und stiehlt Wertsachen aus dem Haus. Die Polizei findet den Täter. Der sagt allerdings: Ich gebe die Wertsachen nur unter gewissen Bedingungen zurück, nämlich erst, wenn der Vater sich ordentlich verhält.»

Es sei arrogant und unehrlich vom Westen, nach allem, was passiert sei, mit dem Finger auf afrikanische Länder zu zeigen.
Andere Aktivist:innen hingegen sind skeptisch, weil die ehemaligen Kolonialmächte noch weit davon entfernt seien, den angerichteten Schaden anzuerkennen. «Und natürlich gibt es Länder, die keine Kolonialmächte waren», so Mathews. Die Schweiz beispielsweise hatte keine Kolonien.
Statt der Zahlung von Reparationen schlägt Mathews vor, den Entwicklungsländern Schulden zu erlassen. Und am wichtigsten sei, Entwicklung anders anzugehen – beginnend mit der ‹Entkolonisierung› unseres Denkens.
Business statt Charity
Vielleicht liegt der Schlüssel in einer grundsätzlich anderen Herangehensweise: Investieren statt Spenden. China macht es vor.

Mehr
China bändelt bei der Entwicklungshilfe mit der Schweiz an
Laut Ekong lässt sich der wachsende Einfluss Chinas in Afrika damit erklären, dass China im Unterschied zu westlichen Ländern nicht die Menschenrechte verbessern wolle, sondern nur aus wirtschaftlichen Motiven präsent sei. «China baut Infrastruktur, um Gewinne zu machen», so Ekong. «Das hat die Infrastrukturen in Afrika erheblich verändert – viel stärker als es die internationale Entwicklungshilfe je vermochte.»
Dass sich diesbezüglich etwas tut, dafür ist Ekong selbst das beste Beispiel. Sie befasst sich als Unternehmensberaterin schwergewichtig mit der Zukunft der Arbeit. Sprich mit der Frage: Was braucht es, damit Menschen gern in einem Unternehmen arbeiten? Ekongs Unternehmen Ravelworks AfricaExterner Link ist in Kenia angesiedelt und richtete sich zunächst auf den afrikanischen Markt südlich der Sahara aus, doch inzwischen stammen die Hauptkund:innen aus den USA und Europa. «Das zeigt, wie die Zeiten sich ändern. Westliche Unternehmen suchen Ratschläge bei afrikanischen Unternehmen», so Ekong.
Einheimische anstellen und fair entlöhnen
Peace Direct rät NGOs und staatlichen Entwicklungsagenturen dazu, alle Positionen im Ausland mit lokalem Personal zu besetzen. Noch immer stellten viele internationale NGOs hauptsächlich weisse Expats an – besonders in Kaderstellen –, obwohl es genügend qualifiziertes einheimisches Personal gebe. Auch die massiven Lohnunterschiede zwischen lokalem Personal und westlichen Mitarbeitenden taxiert Peace Direct als strukturellen Rassismus.
Etwas differenzierter sieht es Macamo: «Wenn man dem lokalen Personal Schweizer Löhne bezahlen würde, dann entstünden neue Ungleichgewichte, nämlich zu anderen Einheimischen, die viel weniger verdienen.»
Laut Steinemann sind zahlreiche westliche Arbeitsplätze von Entwicklungshilfegeldern abhängig. «Öffentliche Gelder dürfen nicht zur Aufrechterhaltung einer Entwicklungshilfe-Industrie eingesetzt werden», mahnt sie und prangert die hohen Löhne bei der schweizerischen Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit DEZA an.

Was macht die Schweiz?
Die Debatte um Dekolonisierung der Entwicklungshilfe ist bei den schweizerischen Behörden angekommen. Ein Sprecher des Aussendepartements schreibt auf Anfrage, die DEZA passe ihre Ansätze an, ohne sich dabei jedoch auf die Terminologie der ‹Dekolonisierung der Entwicklungshilfe› zu beziehen. «Die DEZA fördert die interkulturelle Kompetenz ihrer Mitarbeitenden», schreibt etwa der Sprecher, oder: «Die DEZA passt ihre Terminologie regelmässig an: Sie spricht von internationaler Zusammenarbeit und weniger von Entwicklungshilfe.» Auch greift die DEZA zu Evaluationen und Bewertungen.
Das klingt nicht gerade nach der grossen Revolution. Auch Kimon Schneider, Dozent am Center for Development and Cooperation NADEL an der ETH Zürich, sagt: «Die DEZA setzt sich indirekt mit verschiedenen Themen der Dekolonisierung auseinander, aber könnte und sollte dies systematischer und expliziter tun.»
Fairerweise müsse man aber sagen, dass die Praxis der Schweiz im Vergleich zu anderen Ländern ziemlich partizipativ sei. Vielleicht helfen der Schweiz also beim Abbau kolonialistischer Attitüden jene Rezepte und Werte, die sich bereits innenpolitisch bewährt haben: Direkte Mitbestimmung, Einbezug der Minderheiten und Dialog zwischen den Kulturen.
Mehr

In Übereinstimmung mit den JTI-Standards













Einen Überblick über die laufenden Debatten mit unseren Journalisten finden Sie hier. Machen Sie mit!
Wenn Sie eine Debatte über ein in diesem Artikel angesprochenes Thema beginnen oder sachliche Fehler melden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an german@swissinfo.ch