Der weite Weg zur Digitalisierung von Patientendaten in der Schweiz

Die Schweiz ist bei der Digitalisierung der Patientendaten international im Rückstand. So gelinge der Übergang zu einem modernen Gesundheitswesen nicht, sagt der Bioinformatiker Torsten Schwede.
«Haben Sie schon einmal versucht, ihren Arzt nach ihrer elektronischen Patientenakte zu fragen?», fragt Torsten Schwede. Der Bioinformatiker ist Vizerektor Forschung an der Universität Basel und Leiter einer Forschungsgruppe zum digitalen Gesundheitswesen am Schweizerischen Institut für Bioinformatik. Er fügt an: «Probieren Sie es aus, wenn Sie schmunzeln wollen.»
«Ärzte kommunizieren untereinander oft noch per Fax. Es gibt also nicht so etwas wie eine elektronische Patientenakte, in der alle Informationen strukturiert zusammenfliessen.»
Torsten Schwede
Tatsächlich ist die Situation uneinheitlich. «In einigen Fällen sind Patientendaten auf Papier, in anderen Fällen sind sie digital gespeichert. Ärzte kommunizieren untereinander oft noch per Fax. Es gibt also nicht so etwas wie eine elektronische Patientenakte, in der alle Informationen strukturiert zusammenfliessen», sagt Schwede.
Und selbst wenn die Patientendaten digital vorliegen, sind sie in verschiedenen Formaten und auf unterschiedlichsten Systemen gespeichert. Das führt zu grossen Problemen bei der Interoperabilität der Daten. Mit konkreten Folgen: So wurde zum Beispiel zu Beginn der Corona-Pandemie deutlich, dass die Schweiz Schwierigkeiten hatte, den Überblick über die Infektionen zu behalten, weil die Kantone neue Fälle manuell meldeten und per Fax an die Zentralregierung schickten, anstatt digitale Kanäle zu nutzen.
Laut Schwede braucht es kompatible digitale Krankenakten, um innovative Forschung zu unterstützen und fortschrittliche Technologien wie Künstliche Intelligenz (KI) im medizinischen Bereich nutzen zu können. Zudem ermögliche das digitale Patientendossier eine stärker personalisierte Gesundheitsversorgung, die etwa die individuelle genetische Veranlagung eines Patienten berücksichtige und somit eine präzise Diagnose und Behandlung erlaube.
Im Kontext einer Pandemie könnte Künstliche Intelligenz genutzt werden, um besser zu verstehen, bei welchen Patientinnen und Patienten das Risiko für schwere Krankheitsverläufe besteht oder um Impfkampagnen zu optimieren. Doch dafür werden Daten benötigt, die im Moment nicht vorhanden sind.
Das Gesundheitswesen der Zukunft
KI hat bewiesen, dass sie in den Bereichen Biotechnologie und bildgebende DiagnostikExterner Link den Menschen und seine herkömmlichen Verfahren übertrifft. Die Vorstellung, dass eine nicht-menschliche Intelligenz dem Menschen überlegen sein könnte, mag beängstigend erscheinen. In Tat und Wahrheit sehen Ärzte und Wissenschaftlerinnen KI aber zunehmend als wertvolle Verbündete bei ihrer täglichen Arbeit.
«Künstliche Intelligenz entwickelt sich weltweit zu einem neuen Werkzeug, das die Diagnose und das Screening von Krankheiten entscheidend unterstützen kann.»
Raphael Sznitman
«KI entwickelt sich wirklich weltweit zu einem neuen Werkzeug, das die Diagnose und das Screening von Krankheiten entscheidend unterstützen kann», sagt Raphael Sznitman, Direktor des ARTORG Center for Research in Biomedical EngineeringExterner Link und Leiter des neuen Zentrums für Künstliche Intelligenz in der Medizin an der Universität BernExterner Link.
Sznitman erläutert, wie moderne Künstliche Intelligenz in der Pandemie die verfügbaren klinischen Daten vor allem für diagnostische Zwecke ausgiebig nutzt: KI-Technologien können die durch das Coronavirus verursachten Gesundheitsschäden mit einer Genauigkeit von mehr als 90 Prozent von herkömmlichen Krankheiten unterscheiden. Damit übertrifft der Rechner die Fähigkeiten eines Radiologie-Teams deutlich.
In Zukunft werden immer mehr qualitativ hochwertige Patientendaten aus aller Welt benötigt, um KI in vielen Bereichen der Medizin einzusetzen und Muster von Krankheiten zu erkennen. Snitzman sieht zum Beispiel die Triage als einen Bereich, in dem intelligente Technologien einen grossen Einfluss haben könnten. Aber ohne Daten kann KI ihr Potenzial nicht entfalten. «Deshalb ist die Integration digitaler Informationen in ein einziges System unerlässlich», argumentiert Snitzman.
Es mangelt am Willen
Eine der grössten Herausforderungen: Patientendaten müssen der Forschung zugänglich gemacht werden. Dafür braucht es die Zustimmung der Betroffenen sowie strikte Massnahmen zum Schutz der Privatsphäre. Zudem müssen die Daten so vorliegen, dass sie nicht nur innerhalb der Schweiz, sondern weltweit interoperabel sind. Obwohl die Schweiz bei der Erforschung der potenziellen Anwendungen von KI in der Medizin hervorragend abschneidet, sind Experten überzeugt, dass bis dahin noch ein langer Weg zurückzulegen ist.
«Wir scheitern immer noch an der Aufgabe, klinische Daten zwischen verschiedenen Gesundheitsdienstleistern und -einrichtungen in diesem Land kompatibel zu machen» sagt Schwede. Künstliche Intelligenz könne in der Medizin der Zukunft eine zentrale Rolle spielen, aber nicht mit der Art und Weise, wie derzeit Daten ausgetauscht würden.
«Ohne entsprechende politische Schritte scheitert der Wunsch, Gesundheitsdaten für die Forschung zugänglich zu machen, an rein technischen Grenzen.»
Torsten Schwede
Das Schweizer Gesundheitssystem basiert auf einer föderalistischen Struktur, in der Bund, Kantone und Gemeinden unterschiedliche Kompetenzen haben. Gleichzeitig werden die Gesundheitskosten nicht vom Staat, sondern von privaten Krankenversicherungen übernommen.
Das zersplitterte System macht es kompliziert, Informationen zwischen Praxen und Spitälern sogar innerhalb eines Kantons auszutauschen. Hinter diesen Schwierigkeiten sieht Torsten Schwede vor allem einen fehlenden politischen Willen. «Ohne entsprechende politische Schritte hin zu verbindlichen Interoperabilitätsstandards scheitert der Wunsch, Gesundheitsdaten für die Forschung zugänglich zu machen, an rein technischen Grenzen.»

Auf dem Weg zur personalisierten Medizin
Auf Bundesebene bewegt sich jedoch etwas. 2017 wurde das Swiss Personalized Health Network (SPHN)Externer Link gegründet, eine Initiative des Bundes mit dem Ziel, Dateninfrastrukturen zu koordinieren sowie gesundheitsrelevante Informationen interoperabel und für die Forschung nutzbar zu machen.
Urs Frey, Direktor des Universitäts-Kinderspitals Basel und SPHN-Vorstandspräsident, ist überzeugt, dass es wichtig ist, Forschung und klinische Entscheide auf reale Gesundheitsdaten zu stützen. Nur so erreiche man eine personalisierte Medizin, eine Medizin also, die zunehmend individuelle Merkmale von Patienten berücksichtigt. Die Arbeit des SPHN zielt genau darauf ab. Um das Ziel zu erreichen, müssen aber erhebliche technische Herausforderungen überwunden werden. Das bedingt die Zusammenarbeit aller Interessengruppen im Gesundheitswesen.
«Ziel des SPHN ist es, Daten zu harmonisieren, sowohl in Bezug auf eine einheitliche Terminologie als auch darauf, wie Informationen zwischen verschiedenen Einrichtungen und Akteuren im Gesundheitswesen ausgetauscht werden», erklärt Frey. Bisher hat sich das Projekt auf Universitätskliniken konzentriert, aber das Ziel für die nächsten drei Jahre ist es, die Interoperabilität auch in kantonalen Einrichtungen zu unterstützen.
Nicht nur ein Schweizer Problem
Die Schweiz wäre eigentlich gut aufgestellt, um bei der Digitalisierung des Gesundheitswesens eine Vorreiterrolle zu übernehmen, dank ihrer exzellenten Wissenschaftslandschaft und ihrem gut funktionierenden Gesundheitssystem – und nicht zuletzt wegen der hohen Qualität ihrer Daten, wie Urs Frey betont.
Trotz dieser guten Voraussetzungen ist die Harmonisierung der Patientendaten noch nicht Realität. Laut Frey macht das föderalistische System der Schweiz diesen Prozess besonders kompliziert. Doch das Problem bestehe nicht nur in der Schweiz.
«Eine bessere Digitalisierung führt nicht zu einem Return on Investment. Und jedes Spital in der Schweiz ist ein Unternehmen.»
Sang-il Kim
Gemäss Sang-il Kim, Leiter der Abteilung Digitale Transformation beim Bundesamt für Gesundheit (BAG), ist das Thema noch viel komplexer. Das Hauptproblem ist seiner Meinung nach, dass Spitäler und medizinische Zentren in der Schweiz private Einrichtungen sind, die ohne Anreize kein Geld investieren. «Eine bessere Digitalisierung führt nicht zu einem Return on Investment. Und jedes Spital in der Schweiz ist ein Unternehmen», sagt Sang-il Kim.
Kim nennt ein konkretes Beispiel: Die Schweiz ist Teil von Snomed CTExterner Link, einer internationalen Organisation, die einen globalen Sprachstandard im Gesundheitswesen entwickelt hat. «Die Realität ist aber, dass in der Schweiz niemand dieses System nutzt, weil es keinen Markt gibt und damit auch Anreize für Investitionen fehlen», sagt er. Für Kim ist es schwierig, dass das Schweizer Parlament diesen Anreiz schafft, da auf politischer Ebene die Ansicht vorherrscht, dass solche Investitionen in die Verantwortung der Gesundheitseinrichtungen fallen sollten.
Dieses Hin- und Herschieben der Verantwortung könnte die Bürger in Zukunft teuer zu stehen kommen. Die Covid-19-Pandemie hat gezeigt, dass Länder mit einem modernen digitalen Gesundheitssystem und einer öffentlichen Infrastruktur die Impfkampagne wesentlich effizienter durchführen können – wie Israel, das in Bezug auf seine Einwohnerzahl der Schweiz ähnelt.
«Ich sehe bei der Digitalisierung von Patientendaten ein Verbesserungspotenzial, aber auch Grenzen. Der Weg ist lang, es wird ein paar Jahre dauern. Aber ich habe immer noch Hoffnung», sagt Kim abschliessend. Werden wir bei der nächsten Pandemie bereit sein?

In Übereinstimmung mit den JTI-Standards









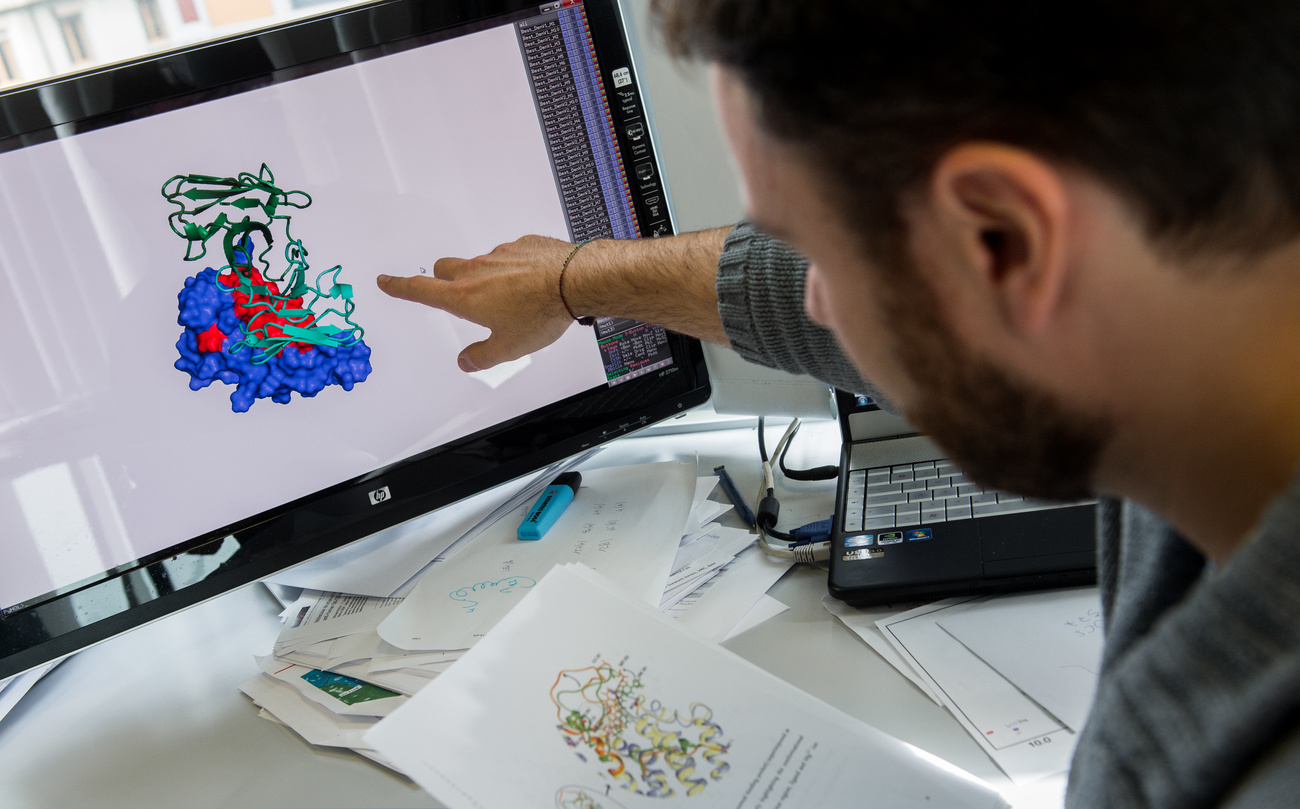




Einen Überblick über die laufenden Debatten mit unseren Journalisten finden Sie hier. Machen Sie mit!
Wenn Sie eine Debatte über ein in diesem Artikel angesprochenes Thema beginnen oder sachliche Fehler melden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an german@swissinfo.ch