Schweizer Erfinder stehen vor Finanzierungshürden

In einem unscheinbaren Bürokomplex neben den Bahngeleisen in Freiburg erhalten Ideen eine Form, darunter ein Skischuh, der die Industrie verändern soll – wenn es nach seinen Erfindern geht. Doch für viele Erfinder ist der Weg über ein Startup eine Gratwanderung.
«Die Kleinräumigkeit der Schweiz macht uns das Leben leichter, was das Networking betrifft. Man kann rasch jedermann treffen», sagt Nicolas Frey, der 39-jährige Gründer der Skischuh-Firma DAHU. «Gleichzeitig ist die kleine Grösse auch ein Problem, weil es weniger Investitionskapital gibt.»
Freys Konzept – ein Skischuh, der aus einem Winterschuh und einer abnehmbaren Aussenschale zum Skifahren besteht – ist ein Schweizer Produkt, und der Erfinder will es so belassen. Er hat Pläne für ein Hauptquartier in Freiburg. Sein Startkapital und die Büroflächen wurden von «Fri Up» zur Verfügung gestellt, dem Innovationsfonds des Kantons Freiburg, der junge Erfinder und ihre Projekte in der Startphase unterstützt.
Doch nun, da seine Firma sich auf die Lancierung des Produkts im September vorbereitet, sind die finanziellen Bedürfnisse über das Startkapital hinausgewachsen. Das Drei-Personen-Team sieht sich nun gezwungen, mit Blut, Schweiss und Tränen zusätzliches Geld aufzutreiben.
Die Idee für DAHU kam Nicolas Frey, nachdem seine Freundin ein Paar Skischuhe gekauft hatte, die als «die komfortabelsten der Welt» verkauft wurden – und diese wegwerfen musste, weil sie ihr Schmerzen bereiteten.
Frey entwickelte einen Prototypen, den er vorsichtig selber auf der Piste ausprobierte. Ein Winterschuh, komfortabel zum Gehen, der in einen Skischuh-Rahmen einrastet.
Der aktuelle DAHU wurde von einigen Profi-Skiläufern getestet und gutgeheissen. Die Schuhe, in Italien produziert, sollen für 690 Fr. über den Ladentisch gehen.
Mit 75% des Finanzierungziels erreicht, plant Frey diesen Herbst die Lancierung von DAHU in ausgewählten Skigeschäften in Wintersportorten mit einem «Soft Launch»-Event auf dem Feegletscher bei Saas Fee (Kanton Wallis).
Über das Startkapital hinaus
DAHU hat sich dafür bei der Online-Plattform «Investiere» angemeldet, die Startups auswählt und für sie Risikokapitalgeber sucht, die direkt investieren können. Das sei hilfreich, sagt Frey, denn die Website informiere ihn über Papierkram und Sorgfaltspflicht-Formulare, die er potenziellen Investoren vorlegen müsse.
Doch Frey wünscht sich, dass Crowdfunding-Plattformen wie «Kickstarter» in den USA, die über webbasierte Kampagnen funktionieren, bei denen alle teilnehmen können, auch Projekte aus anderen Ländern aufnehmen würden. Gegenwärtig können nur US- und britische Bürger mitmachen.
Auch wenn es in der Schweiz bereits einige Crowdfunding-Plattformen gebe, ist laut Frey keine von der Grösse von «Kickstarter» darunter, mit der genügend Gelder für die gegenwärtige Phase seiner Erfindung generiert werden könnten. Das Produkt sorgt aber für immer mehr Marketing- und Produktionskosten.
Andererseits sei viel dabei zu gewinnen, wenn Geld auf die althergebrachte Art und Weise verdient werde – wie das Vertrauen der Investoren und die Anerkennung für hart verdientes Geld. Doch es sei «anstrengend», den eher kleinen Kreis von Investoren in der Schweiz für die zur Vermarktung seines Produktes nötigen Gelder zu beackern.
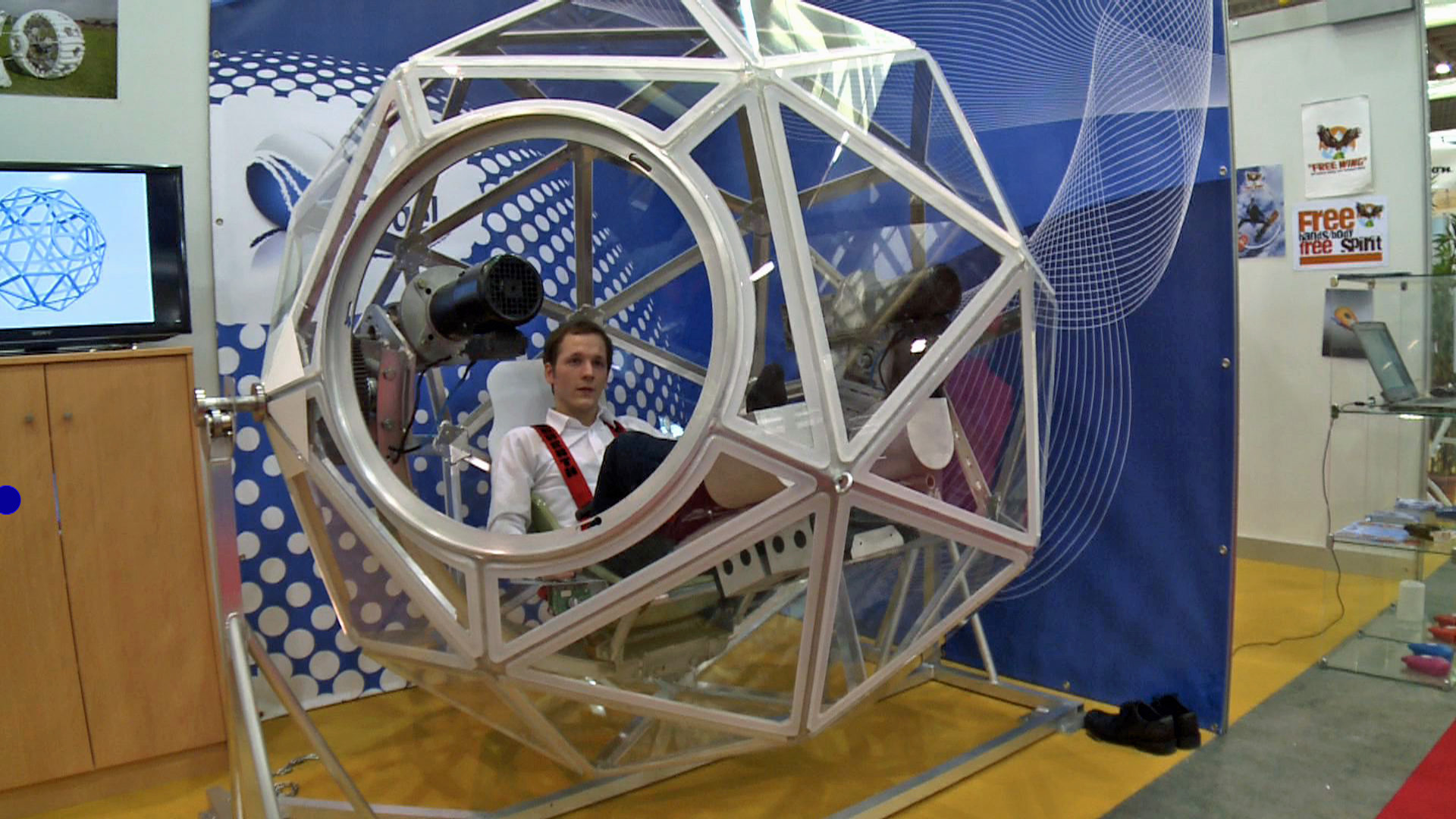
Mehr
Wie neue Erfindungen vermarktet werden
Navigieren im Patentdschungel
Ein Grossteil des Startkapitals von DAHU musste für den Patentierungsprozess aufgewendet werden. Dieser ist in der Schweiz auf einem ersten Niveau recht erschwinglich: Es kostet 200 Franken, um ein Schweizer Patent anzumelden und 500, um es prüfen zu lassen. Doch danach steigen die Kosten rasch an.
Heinz Müller ist Patent-Experte am Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum in Bern und unterrichtet junge Wirtschaftsstudenten über das Patentierungs-System. Er empfiehlt allen Erfindern, die ein Produkt vermarkten wollen, einen Patentanwalt zu engagieren – besonders, weil die Schweiz eines der wenigen Länder der Welt ist, die nicht sicherstellen, dass ein Produkt ein Original ist, bevor das Patent erteilt wird.
In der Schweiz domizilierte Unternehmen beginnen den Patentierungs-Prozess oft in der Schweiz. Dies ist aber nicht Pflicht – viele reichen ein erstes Gesuch beim Europäischen Patentamt (EPO) ein, das Patentschutz in bis zu 40 europäischen Ländern bietet, darunter in der Schweiz.
Beim EPO werden jährlich 30’000 bis 35’000 Gesuche gestellt. Die meisten in der Schweiz anerkannten Patente stammen von diesem Amt.
Beim Schweizer Patentamt gehen pro Jahr 2000 Gesuche ein, von denen 800 bis 900 geprüft werden.
Einige Erfinder reichen auch gleichzeitig einen Antrag in der Schweiz und beim EPO ein und entscheiden sich später, welches Patent sie behalten möchten.
«Wir überprüfen nicht, ob etwas neu ist. Dies ist absolut notwendig, um ein Patent zu erhalten, doch wir prüfen es nicht», erklärt Müller. «Das hat damit zu tun, dass wir ein sehr preiswertes Patentierungs-System haben. Wir sind der Meinung, die Leute sollten das selber überprüfen.»
Sollte ein Produkt bereits patentiert worden sein, könnten Gerichtsprozesse auf den Erfinder zukommen, und er kann sein Produkt nicht mehr verkaufen. Für weitere 500 Franken bietet das Patentamt eine Suche nach Originalen an, bei welcher der Gesuchsteller die Datenbanken des Amtes nach ähnlichen Produkten durchforsten kann.
Doch für Erfinder wie Frey, welche die Originalität ihres Produktes sicherstellen und dieses international vermarkten wollen, ist es noch ein langer – und teurer – Weg. DAHU habe über 50’000 Franken allein in den internationalen Patentierungs-Prozess gesteckt, ohne die ersten Schritte, die in der Schweiz dazu nötig waren.
Trotz der hohen Kosten hat Frey aber nicht bereut, einen Patentanwalt beigezogen zu haben, der ihn im komplizierten Patentdschungel der europäischen, amerikanischen und kanadischen Patentämter unterstützt hat.
Unflexible Investoren
Wie Frey ist auch Müller der Meinung, der Kreis von möglichen Investoren in der Schweiz sei zu klein und unflexibel. Dies habe er bemerkt, als er selber vor 20 Jahren ein Unternehmen für medizinische Diagnose gründen wollte.
Er habe damals einige Investoren gehabt, die ihm mehr Geld zur Verfügung stellen wollten, als er gebraucht hätte, die aber der Meinung waren, mit kleineren Investitionen, wie er sie benötigt hätte, würden sie zu wenig Return on Investment erhalten. Das Geld kam nie – das Unternehmen scheiterte.
Das Swiss Creative Center bringt in der Region Neuenburg kreative Personen mit lokalen Händlern zusammen, die in ihren Läden kleine Projekte realisieren wollen.
Beispiele umfassen einmalige Verpackungslösungen und neue Arten der Produktepräsentation.
Das Projekt wird vom Kanton Neuenburg und dem Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) unterstützt.
Markus Hosang von «BioMedPartners», einer Basler Firma, die in Jungunternehmen der Gesundheitsbranche investiert, begegnet diesem Problem jeden Tag. «Die Finanzierung mit Seed Capital funktioniert in der Schweiz recht gut», sagte er kürzlich in einem Artikel der NZZ am Sonntag.
Für die weitere Entwicklung eines Produkts würden aber Dutzende von Millionen Franken benötigt. «Die sind auf dem Schweizer Finanzmarkt praktisch nicht aufzubringen.»
Lokal anfangen
Laut Hosang ist Startkapital auf kantonaler Ebene viel leichter zu erhalten, wo Projekte wie «Fri Up» Erfinder bei den ersten Schritten unter die Arme greifen.
Der Kanton Neuenburg hat mit dem Swiss Creative Center einen kleineren, lokaleren Zugang gewählt. Dessen Ziel ist, lokale Unternehmen mit Designern und Kreativen zusammenzubringen, um kleine Projekte zur Produktionsreife zu bringen.
So suchte beispielsweise ein lokaler Käser, der einen neuen Streichkäse entwickelt hatte, nach einem einzigartigen Design für ein Kostproben-Tablett, um das Produkt an den Kunden zu bringen.
Eine Gruppe junger Designer stieg darauf ein und entwickelte ein Konzept, das den Kunden erlaubte, die Kostproben des Streichkäses in separaten Schälchen mit verschiedenen Lebensmitteln zu mischen (siehe Foto).

«Ideen zu generieren ist einfach, doch die Phasen der Produktion und der Geldbeschaffung sind immer lang und hart», sagt Jungdesignerin Laetitia Florin, die am Käsetablett-Projekt mitgearbeitet hat. «Deshalb funktioniert dieses lokale Modell sehr gut. Lokale Händler können im Kleinen sehr rasch Entscheidungen treffen.»
Wenn man das Produkt aber über das lokale Gebiet hinaus vermarkten und verkaufen wolle, bestehe immer noch die Hürde der Finanzierung, die mit individueller Geldbeschaffung überwunden werden müsse, sei es durch den Designer oder den Händler, erklärt Florins Kollegin Audrey Temin.
Beide Frauen sind sich einig, dass der kreative Prozess am meisten Spass machte – dann folgte die Aufgabe, die sie «am meisten hassten»: Zum Telefonhörer greifen und potenzielle Investoren anrufen.
(Übertragen aus dem Englischen: Christian Raaflaub)

In Übereinstimmung mit den JTI-Standards










Einen Überblick über die laufenden Debatten mit unseren Journalisten finden Sie hier. Machen Sie mit!
Wenn Sie eine Debatte über ein in diesem Artikel angesprochenes Thema beginnen oder sachliche Fehler melden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an german@swissinfo.ch