Defektes Gen steigert Verlangen nach Alkohol

Ein defektes Gen führt zu erhöhten Werten des Botenstoffs Glutamat im Gehirn und steigert damit das Verlangen nach Alkohol.
Dies zeigt eine Studie der Schweizer Universität Freiburg. Die Ergebnisse dürften bei Therapien von Alkoholsüchtigen von grossem Nutzen sein.
Die Freiburger Biochemiker konnten in ihrer Studie neue Zusammenhänge zwischen der inneren Uhr und dem Alkoholkonsum beweisen.
Sie mutierten dafür das so genannte Gen «Per2» bei Mäusen. Wurde den mutierten Mäusen Wasser und Alkohol vorgelegt, so bevorzugten sie häufiger Alkohol als ihre nicht mutierten Artgenossen.
Die Forscher stellten weiter fest, dass die Mäuse mit dem manipulierten Gen einen zu hohen Gehalt des Botenstoffs Glutamat im Hirn aufwiesen. Beim Menschen verändert «Per2» seine Aktivität, wenn die innere Uhr wie beispielsweise bei Piloten oder Nachtarbeitern dereguliert wird.
Die Biochemiker gehen davon aus, dass wie bei den Mäusen beim Menschen ein defektes «Per2»-Gen zu erhöhten Glutamatwerten im Gehirn führt und das Verlangen nach Alkohol steigert.
Gezielterer Medikamenteneinsatz
Der entdeckte Zusammenhang zwischen dem Gen und dem Alkoholkonsum könnte in Zukunft bei der Behandlung von Alkoholsucht zentral sein. Er dürfte sich auch auf den Einsatz des gebräuchlichen Medikaments «Acamprosat» auswirken.
Dieses vermag sowohl bei Mäusen wie bei Menschen den Glutamatspiegel im Gehirn wieder zu senken. Das Verlangen nach Alkohol verschwindet in der Folge, ohne dass Entzugserscheinungen auftreten.
Bis anhin wurde bei Alkohol-Entzügen unabhängig vom Typus der Alkoholsucht «Acamprosat» verabreicht. Ein solches Vorgehen mache jedoch wenig Sinn, denn auf das Medikament würden nur Patienten mit erhöhtem Glutamatspiegel ansprechen und das seien lediglich zehn Prozent der Alkoholiker.
Das Problem war bislang, dass Glutamat sich im Gehirn nur schwierig messen lässt. Hingegen ist es relativ einfach, einen Defekt im Per 2-Gen zu ermitteln. Das Medikament kann damit in Zukunft in der Therapie viel gezielter eingesetzt werden.
Innere Uhr
Der Freiburger Biochemiker Urs Albrecht untersucht mit seinem Team seit Jahren die Mechanismen der inneren Uhr und ihre Auswirkung auf das Denken und Verhalten von Menschen und Mäusen.
Die innere Uhr ist besonders für die Körpertemperatur, den Hormonspiegel und das Schlafverhalten in einem Tagesrhythmus von 24 Stunden verantwortlich und reguliert den Stoffwechsel in einem Organismus. Sie sorgt dafür, dass der Körper zur richtigen Zeit Höchstleistungen erbringt und sich in der Nacht durch Schlaf wieder regeneriert.
Gerät dieser Rhythmus aus dem Takt, können gesundheitliche Störungen wie Depressionen, Schlaf- und Herzprobleme auftauchen. Die innere Uhr bewirkt damit, dass sich der Körper mit der Umwelt synchronisiert. Probleme mit der Synchronisierung treten etwa bei einem Jetlag auf.
Bei dem Projekt, das vom Schweizerischen Nationalfonds und der EU finanziert wurde, kooperierten die Freiburger Biochemiker eng mit Forschern in Mannheim (Deutschland).
Die Freiburger Forscher wollen nun in den nächsten Jahren untersuchen, wie die innere Uhr den Alterungsprozess und den geistigen Zustand des Gehirns beeinflusst.
swissinfo und Agenturen

In Übereinstimmung mit den JTI-Standards


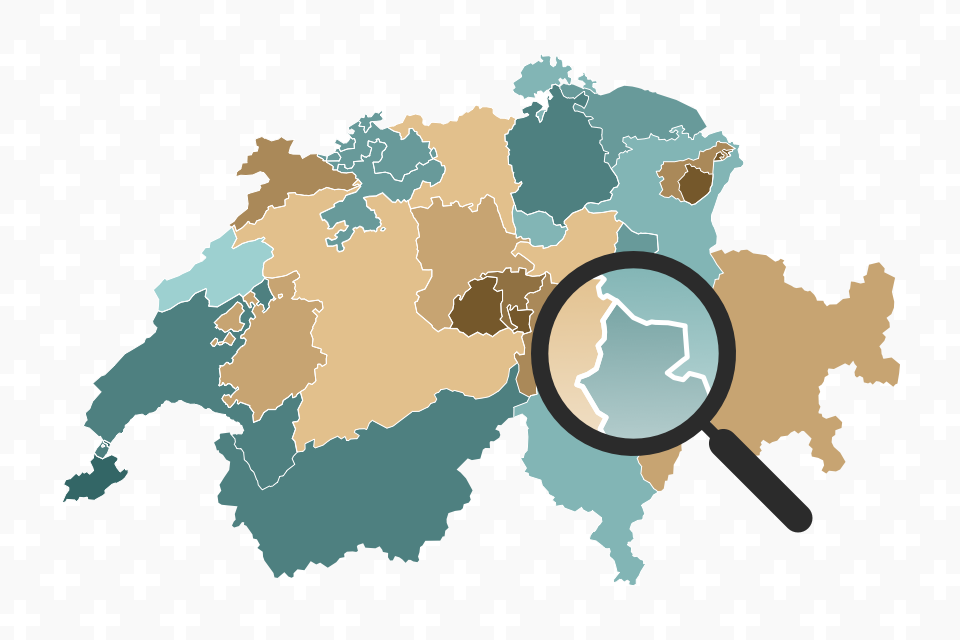





Einen Überblick über die laufenden Debatten mit unseren Journalisten finden Sie hier. Machen Sie mit!
Wenn Sie eine Debatte über ein in diesem Artikel angesprochenes Thema beginnen oder sachliche Fehler melden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an german@swissinfo.ch