Der lange Weg zum Kompromiss
Die Schweiz tut sich schwer mit konkreten Massnahmen zur Senkung des CO2-Ausstosses. Dies, obwohl sie sich bereits 1992 in Rio dazu verpflichtet hatte.
Die Chronologie der wichtigsten Schritte.
Vor bald 13 Jahren hat sich die Schweiz am Umweltgipfel von Rio verpflichtet, den CO2-Ausstoss zu senken. Dasselbe tat sie fünf Jahre später im Kyoto-Protokoll und im Jahr 2000 mit dem CO2-Gesetz.
Mai 2000: Das CO2-Gesetz tritt in Kraft. Der CO2-Ausstoss soll bis 2010 um 10% gegenüber 1990 gesenkt werden – mit freiwilligen Massnahmen, notfalls mit einer Lenkungsabgabe auf Brenn- und Treibstoffen.
Das Nein und die freiwilligen Abgaben
24. Sept. 2000: Zusammen mit der Solarinitiative werden auch die Vorlagen über eine Förderabgabe (zu Gunsten erneuerbarer Energien) und die Grundnorm für eine ökologische Steuerreform in der eidgenössischen Volks-Abstimmung abgelehnt.
30. Jan. 2001: Bundespräsident Leuenberger lanciert das Programm Energie Schweiz, das Nachfolgeprogramm von Energie 2000. Es dient als Grundlage für Vereinbarungen zwischen Bund, Wirtschaft und Energieagenturen über freiwillige Massnahmen zum Energiesparen und zur Senkung des CO2-Ausstosses.
Oktober 2002: Das Bundesamt für Energie stellt in einer Bilanz von Energie Schweiz fest, dass die freiwilligen Massnahmen nicht ausreichen, um die Vorgaben des CO2-Gesetzes bis 2010 zu erreichen.
Der Bundesrat setzt auf Varianten
Herbst 2002: Die Erdölvereinigung schlägt als Alternative zur CO2-Lenkungsabgabe den «Klimarappen» auf jeden Liter verkauftem Treibstoff vor. Von den Einnahmen sollen zwei Drittel für Massnahmen im Inland eingesetzt werden, ein Drittel im Ausland zur Reduktion von Treibhausgasen.
9. Juli 2003: Nach Ratifizierung durch das Parlament tritt die Schweiz als 111. Staat dem Kyoto-Protokoll bei.
Okt. 2004: Obschon Wirtschaft und Umweltverbände den Bundesrat auf eine klare Entscheidung zwischen Klimarappen und CO2-Abgabe drängen, schickt dieser vier Varianten in die Vernehmlassung. Zwei setzen auf eine CO2-Abgabe, eine verbindet CO2-Abgabe und Klimarappen, und eine setzt allein auf den Klimarappen.
Der Kompromiss setzt sich durch
Jan. 2005: In der Vernehmlassung treten Umweltverbände, Wissenschafter und die Linke für die CO2-Abgabe ein, die Wirtschaft, Autoverbände und die bürgerlichen Parteien sprechen sich mehrheitlich für den Klimarappen aus. Mehrere Kantone sind für eine Kombinierung beider Elemente.
23. März 2005: Der Bundesrat spricht sich für die Kompromiss- Variante aus: CO2-Abgabe von 9 Rappen pro Liter Brennstoff und (auf Probe) ein Klimarappen auf den Liter Treibstoff.
swissinfo und Agenturen

In Übereinstimmung mit den JTI-Standards

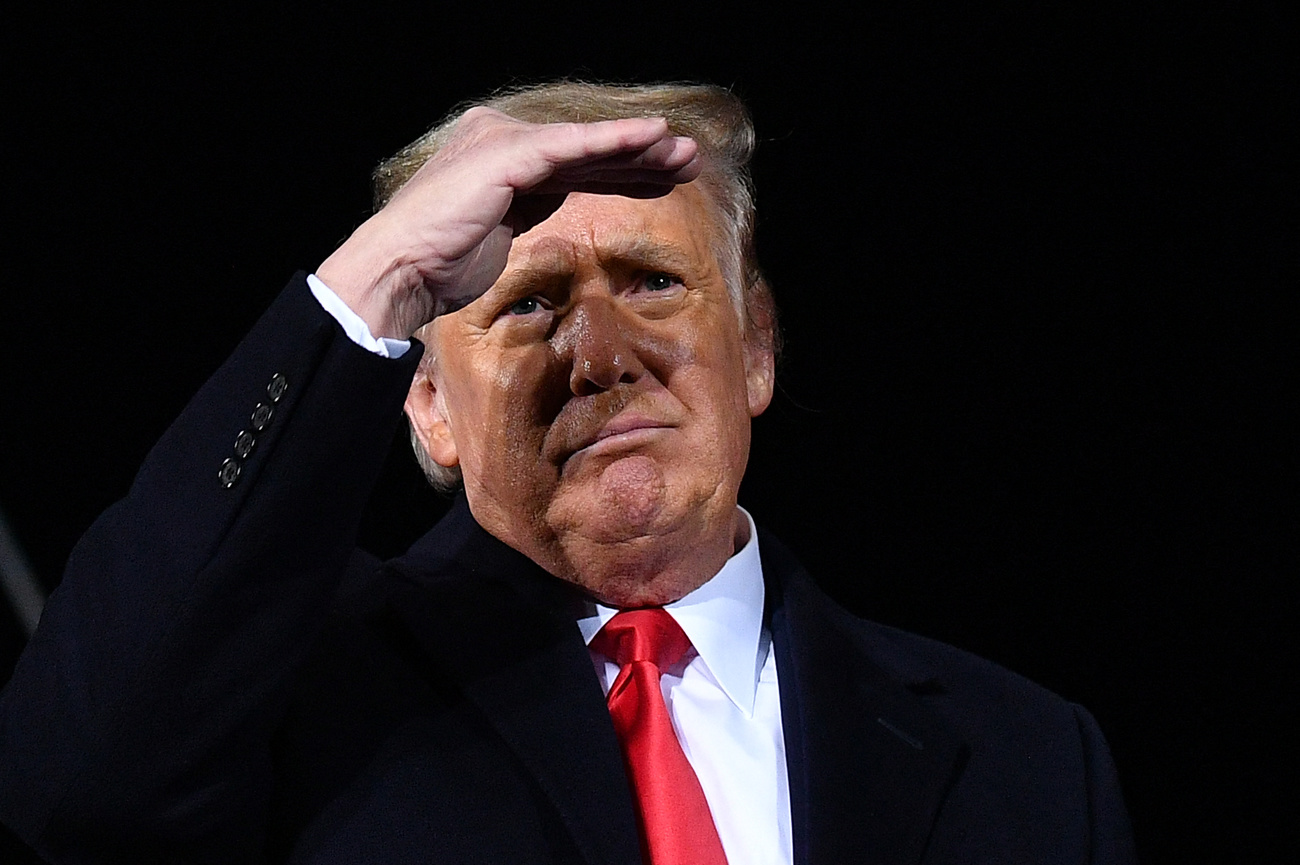
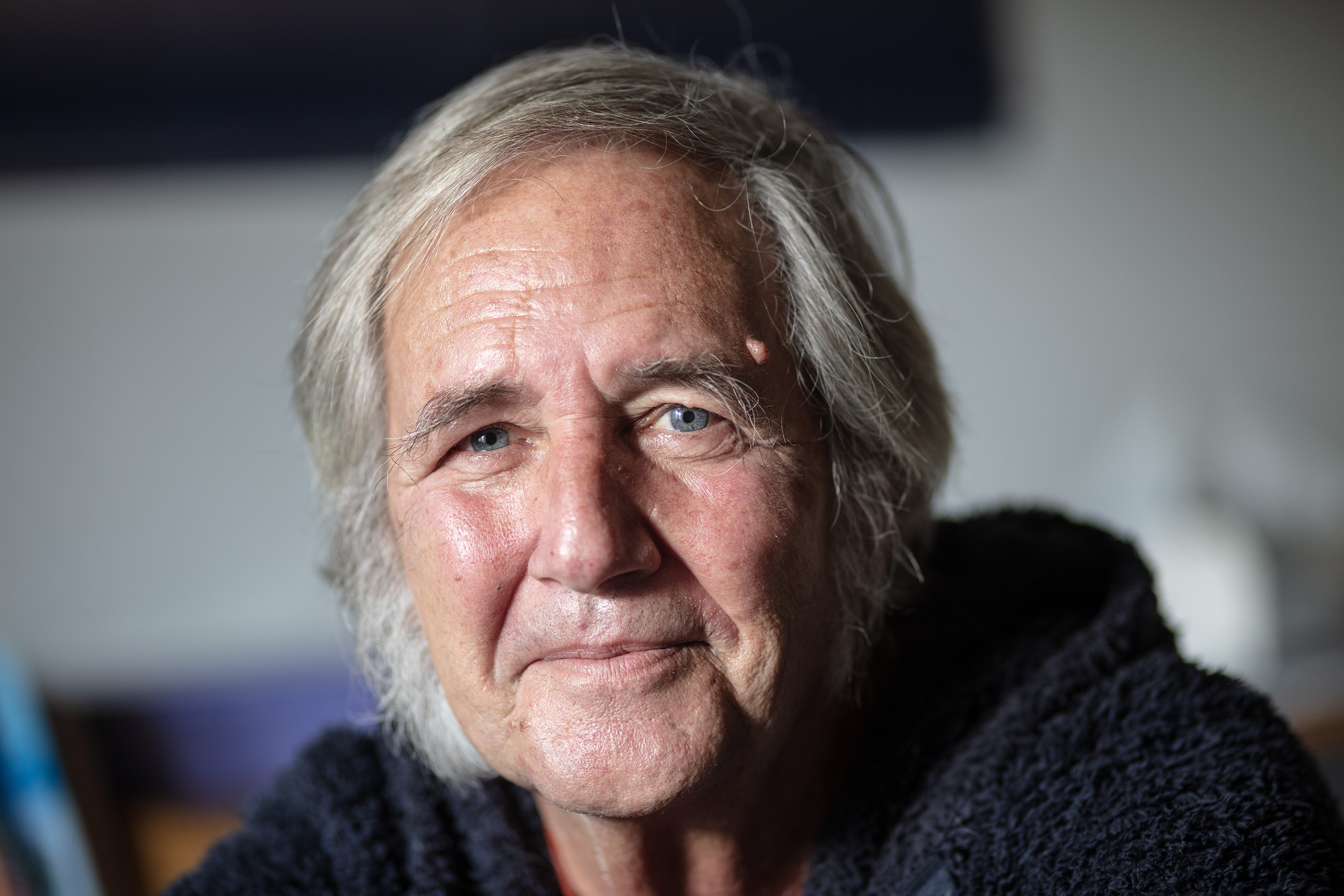





Einen Überblick über die laufenden Debatten mit unseren Journalisten finden Sie hier. Machen Sie mit!
Wenn Sie eine Debatte über ein in diesem Artikel angesprochenes Thema beginnen oder sachliche Fehler melden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an german@swissinfo.ch